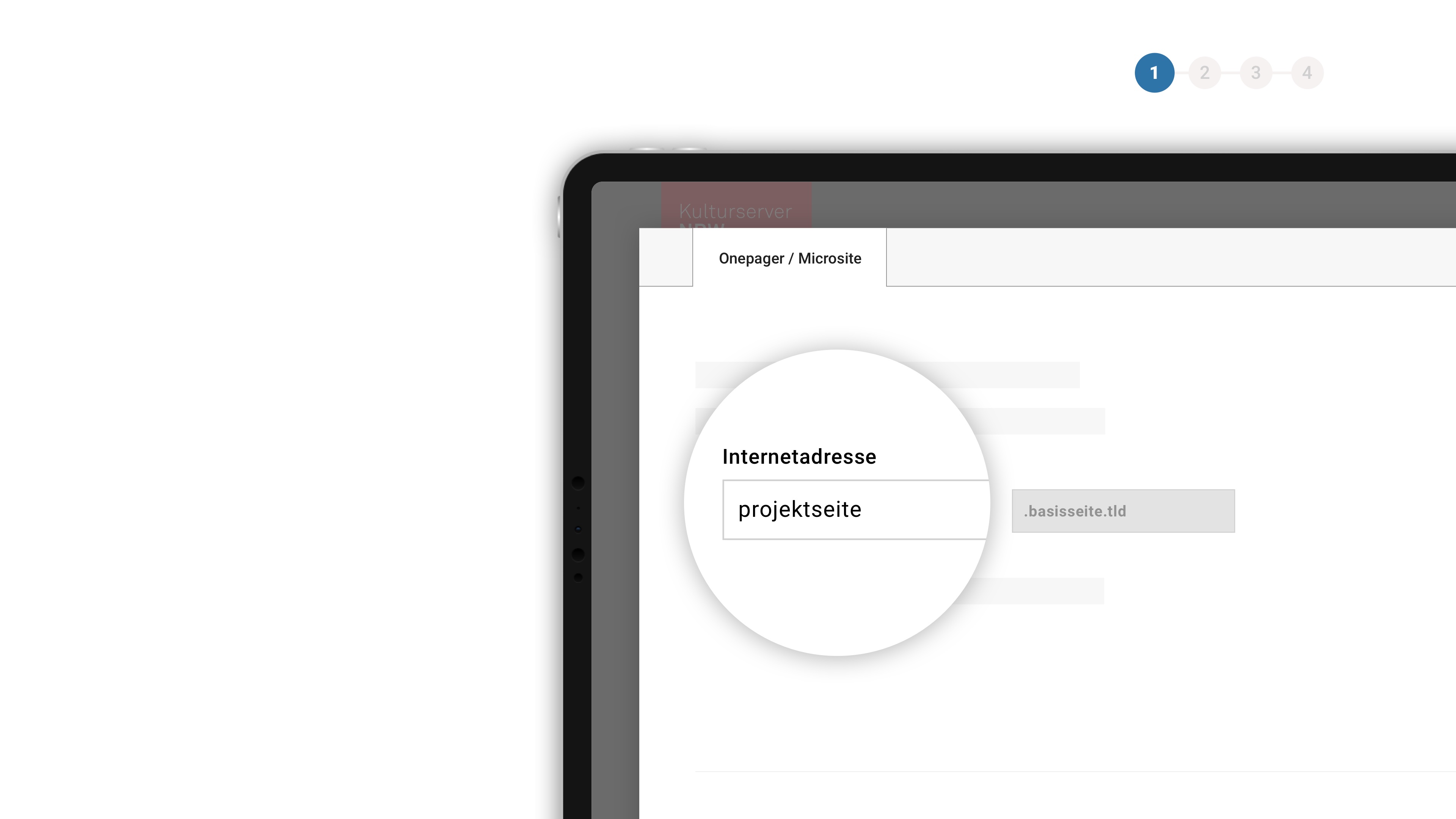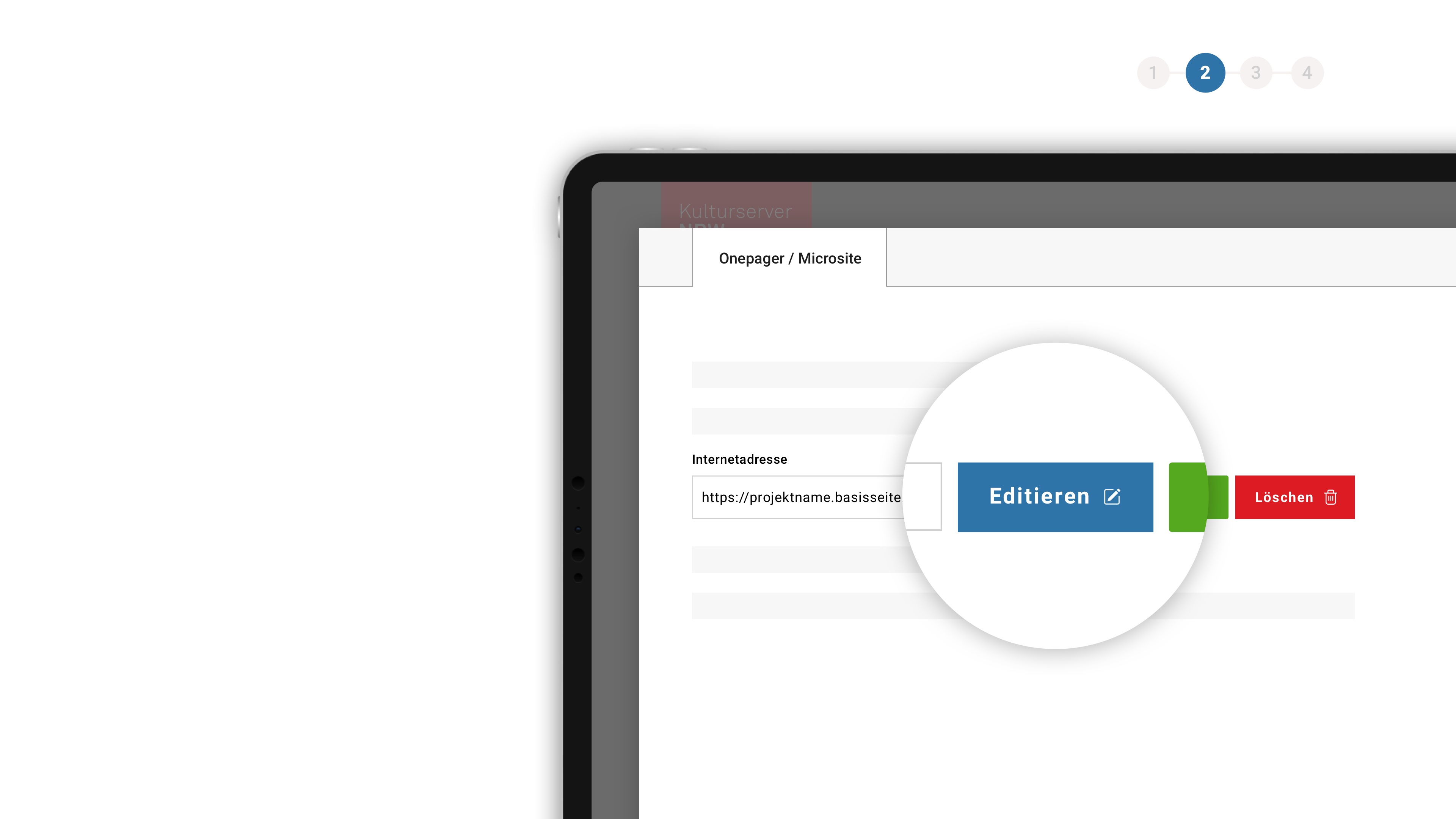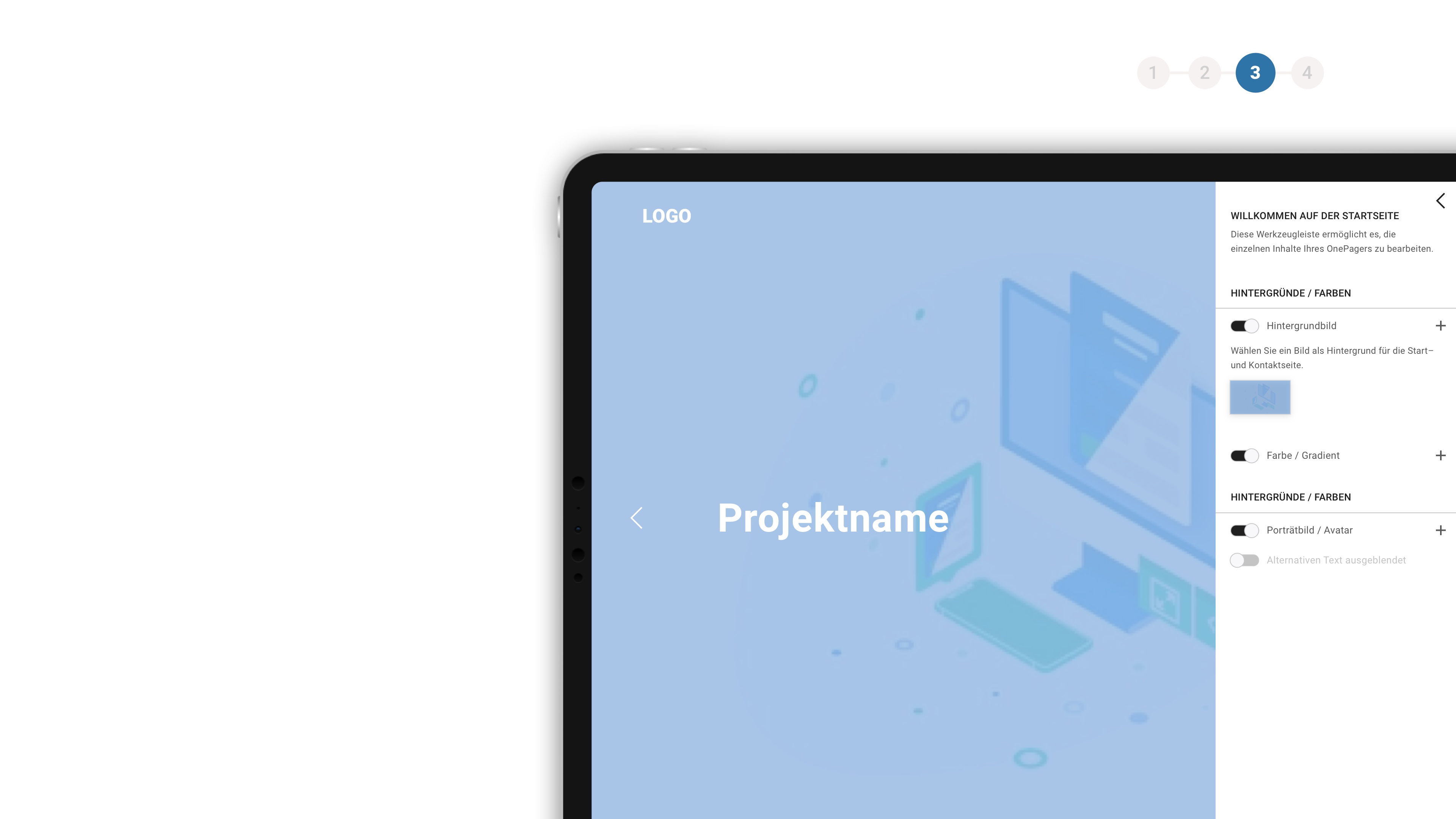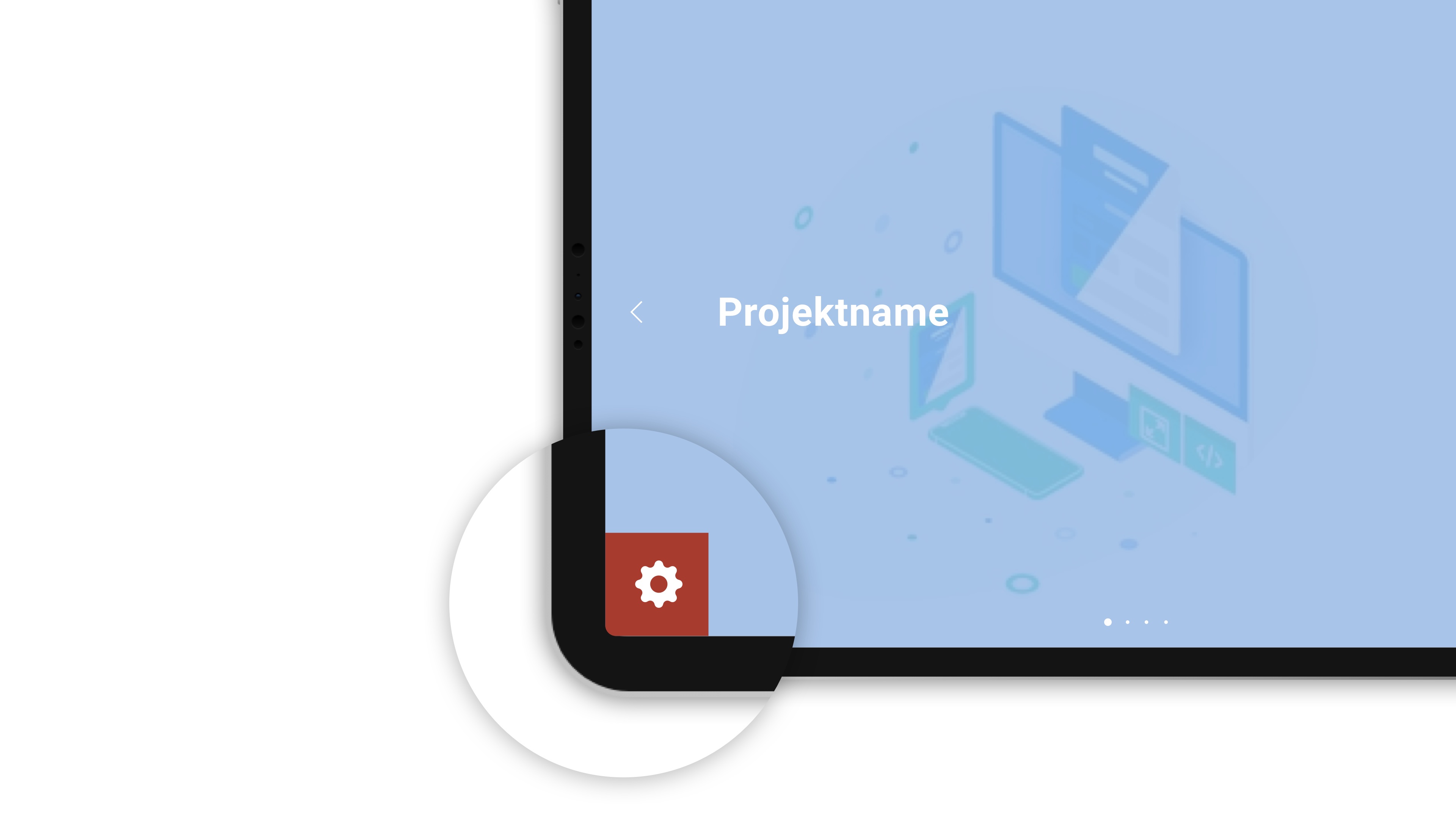Singend über das Singen singen - Deutsche Oper Berlin
Aus dem Programmheft
Singend über das Singen singen
Überlegungen zu Wagners DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG von Sebastian Hanusa
In seiner 1851 erschienenen „Mitteilung an meine Freunde“ schrieb Wagner in Hinblick auf die ersten Entwürfe seines MEISTERSINGER-Vorhabens, er plane eine komische Oper „leichteren Genres“. Und bei aller Tiefe und Ernsthaftigkeit hat die 1868 letztlich uraufgeführte Oper durchaus komische Momente – und dies auf unterschiedlichen Ebenen von Humor und Ironie. Es gibt den derben, teils brutalen Humor der Schadenfreude über das Scheitern anderer, etwa darüber, dass Beckmesser in den Augen des auf der Festwiese versammelten Publikums als Künstler versagt. Es gibt die Parodie der Meistersingerzunft und ihrer strengen, teils kuriosen, teils kleinbürgerlich-engen Kunstregulatur. Es gibt aber auch eine Form von immanenter Ironie, deren Grundlage eine semiotische Mehrdeutigkeit und ein hierauf basierender Schwebezustand des Bezeichnens und Bedeutens ist, der dem Stück mit einer schon im Titel angelegten dramaturgischen Grundkonstellation eigen ist.
Das Stück heißt DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG und benennt damit das Personal, den Ort und das soziale Umfeld der Bühnenhandlung. Zugleich könnte man aber spitzfindig anmerken, dass der Titel doch, insbesondere in seiner üblichen Kurzform MEISTERSINGER schlichtweg „doppelt gemoppelt“ sei: Was anderes als Meistersinger – oder, seit kürzerem, Meistersinger*innen – erwartet das Publikum denn sonst, auf der Bühne zu erleben, gerade an einem renommierten Opernhaus wie der Deutschen Oper? Der „Meistertitel“ im Sängerfach sollte Mindestvoraussetzung für einen Auftritt in einer Wagner-Oper sein und muss nicht im Titel der Veranstaltung noch einmal angekündigt werden!
Was zunächst wie der Versuch eines witzigen Sprachspiels erscheint, beschreibt einen dramaturgischen Kernbestand des Stückes, der durch die Regiesetzung des Teams Wieler/Viebrock/Morabito, dieses in einer Musikhochschule der 90er Jahre spielen zu lassen, lediglich auf die Spitze getrieben und zugleich näher an unsere heutige Lebensrealität herangerückt wurde: In den MEISTERSINGERN wird mit einer grundlegenden, über die Jahrhunderte ihrer Existenz immer wieder kontrovers diskutierten Grundkonvention der Gattung Oper gebrochen: Das, was in der Realität gesprochen wird, wird auf der Opernbühne gesungen.
Exemplarisch für die Auseinandersetzung mit dieser Tatsache sei Ferruccio Busoni zitiert, der 1907 in seinem „Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst“ gegen den Anspruch des damals in Italien entstandenen Verismo auf möglichst wahrheitsgetreue Nachahmung realen Lebens in der Oper polemisierte: „Immer wird das gesungene Wort auf der Bühne eine Konvention bleiben und ein Hindernis für alle wahrhaftige Wirkung: aus diesem Konflikt mit Anstand hervorzugehen, wird eine Handlung, in welcher die Personen singend agieren, von Anfang an auf das Unglaubhafte, Unwahre, Unwahrscheinliche gestellt sein müssen, auf dass eine Unmöglichkeit die andere Stütze und so beide möglich und annehmbar werden.“
So sei der Oper demnach gerade nicht Ähnlichkeit zwischen Darstellung und Dargestelltem wesentlich – zumindest bezüglich des von Sängerdarsteller*innen entäußerten Wortes –, sondern der Bruch hiermit, das so komplett unrealistische Singen des eigentlich Gesprochenen. Dies gilt zumindest für durchkomponierte Werke, um die es hier ausschließlich gehen soll. So ist etwa der Wechsel zwischen Gesprochenem und Gesungenem in Musiktheaterformen wie dem deutschen Singspiel ein zentraler Gegenstand der theoretischen Auseinandersetzung mit jener Gattung. Das soll aber hier nicht weiter verfolgt werden.
Quer durch die Operngeschichte wird jedoch immer wieder auch singend gesungen, finden sich in eine Opernhandlung eingefügte szenische Gesangsstücke. Man denke etwa Don Giovannis „Deh, vieni alla finestra“ oder Almavivas morgendliches Ständchen „Ecco, ridente in cielo“, aber auch an diverse „Weisen“ in Richard Wagners Musiktheater, vom Lied der Steuermanns im HOLLÄNDER über die Hirtenweise im TRISTAN bis hin zu den Liedern des Sängerwettstreits im TANNHÄUSER, dem quasi Schwesterwerk der MEISTERSINGER, als welches diese, nach Wagners ersten Entwürfen als einer Oper „leichteren Genres“, parodistisch antworten sollten.
All die genannten Stücke sind auf ihre Weise integraler Bestandteil einer Bühnenhandlung, sind zugleich aber Sonderfälle, in denen ein Sänger singend „singt“ und nicht singend „spricht“. Formal handelt es sich dabei in der Regel um abgeschlossene musikalische Einheiten, die damit klar von Vorangehendem wie Nachfolgendem getrennt sind. Sie entsprechen mit ihrer musikalischen Form jenen Stücken – einem Lied, einem Ständchen oder einer Ballade – wie sie auch außerhalb der Oper, in der realen Welt als reales Ständchen etwa in Sevillas Straßen unter Rosinas Fenster erklungen sein könnte. Und hinzu kommt oftmals, zur eindeutigen klanglichen Kennzeichnung des jeweiligen Stückes, ein besonderes Begleitinstrument, oftmals ein gezupftes, das entweder im Orchester sonst gar nicht oder zumindest nicht derart exponiert eingesetzt wird. Im GIOVANNI ist dies die Mandoline, in Rossinis BARBIERE die Gitarre, bei Wagner sind es das Englisch Horn im TRISTAN oder die Harfe in den Wettbewerbsliedern des TANNHÄUSER.
Was in all den genannten Fällen geschieht, ist ein grundlegender Bruch mit der Opernkonvention und damit deren etabliertem Zeichensystem. Auf den verschiedenen Ebenen des multimedialen Kunstwerks Oper gibt es verschiedene Weisen der Bezeichnung und Darstellung. Im Fall der Sprache basiert dieses auf der Nichtähnlichkeit zwischen der Sprache in der Realität und der auf der Opernbühne und bildet damit die Grundlage für das von Busoni erwähnte „Unglaubhafte, Unwahre, Unwahrscheinliche“: Dort wird gesprochen, hier gesungen. Wobei hiermit das Singen als Medium der Darstellung der gesagt-gesungenen Inhalte und Gefühle letztlich selber durchlässig sein sollte. Zur Implosion und zugleich zur Verdopplung des Systems kommt es aber, wenn singend etwas dargestellt wird, was in der „Realität“ ohnehin schon gesungen wird. Das auf der Bühne „gesungene“ Stück wird dabei als Fremdobjekt in den Kontext der Bühnenhandlung hineinimplantiert. Damit erfüllt es natürlich auch eine Funktion, etwa die des Lobpreises verschiedener Erscheinungsweisen der Liebe durch Wolfram, Tannhäuser und Walther, wird aber zugleich zum buchstäblichen Beispiel seiner selbst, zu einem exemplifizierenden Zeichen für „so ist Liebeslobpreis-Singen“. Das Gesungene selber wird als Gegenstand exponiert, ist nicht mehr nur transparent hinsichtlich eines zu besingenden Gegenstands, sondern zugleich selber Gegenstand der Bezeichnung – und dies paradoxerweise, indem der Sänger einfach so weitersingt, wie er es vorher auch bereits getan hat.
Auch in den MEISTERSINGERN wird sehr viel „Singen“ gesungen. Doch mit einer entscheidenden Akzentverschiebung gegenüber den genannten Beispielen, indem die fundamental gegensätzlichen Bezeichnungsweisen von gesungenem und gesprochenem Singen nun Akteure werden in einem Spiel mit und über Bezugnahme. Dabei werden die jeweiligen Bezeichnungsweisen zur Spielmasse innerhalb einer Bühnenhandlung, die gerade dieses zu ihrem Gegenstand macht: In den MEISTERSINGERN geht es darum, wie ein guter, wahrhaftiger, expressiver und zugleich geschmackvoller und ästhetisch schöner Gesangs – in einer Symbiose aus Komposition und Aufführung desselben – klingen soll. Und es geht darüber hinaus um die Begründung und Sinnhaftigkeit der zum Erreichen dieses Ziels aufgestellten Regeln – bis hin zur Frage, wie sich überhaupt Regelwerk und Phantasie und künstlerische Inspiration zueinander verhalten. Dies wird verhandelt, indem ständig zwischen gesungenem Singen und gesungenem Sprechen hin- und hergewechselt wird, zudem aber indem über lange Passagen hinweg das „sprechende“ Singen ein Sprechen über das Singen ist. Insgesamt wird in den MEISTERSINGERN deutlich mehr über das Singen „gesprochen“ als einfach nur „gesungen“. Während das dann dort implementierte „singende“ Singen wiederum innerhalb der Bühnenfiktion zur Exemplifikation etwa eines „man könnte es so singen – oder eben auch anders“ wird. Bis hin zu jener Szene, in der Sachs Walther im dritten Aufzug beibringt, wie man komponiert, wie also Gesungenes produziert wird, und dem Publikum dieses wiederum singend vorgeführt wird – während dies, so, wie immer, wenn Walther, Beckmesser oder Sachs jemand anderem etwas vorsingen, auch „einfach“ nur jener Sonderfall einer Exemplifikation singenden Singens ist ...
Wagner selber scheint dieser Tanz der Bezugs- und Bedeutungsebenen nicht ganz geheuer gewesen zu sein. Und so hat er, stets pedantisch um Klarheit bemüht, im Libretto alle Passagen gesungenen Singens mit An- und Abführungszeichen markiert. Verhindern konnte er damit aber nicht, dass er in den MEISTERSINGERN ein Spiel mit semiotischer Mehrdeutigkeit entfacht hat. Und damit ein Spiel der Bezüge und Bezeichnung – ein Spiel, das Zwischenräume öffnet, das Uneindeutigkeit ermöglicht oder auch einfach nur Humor.