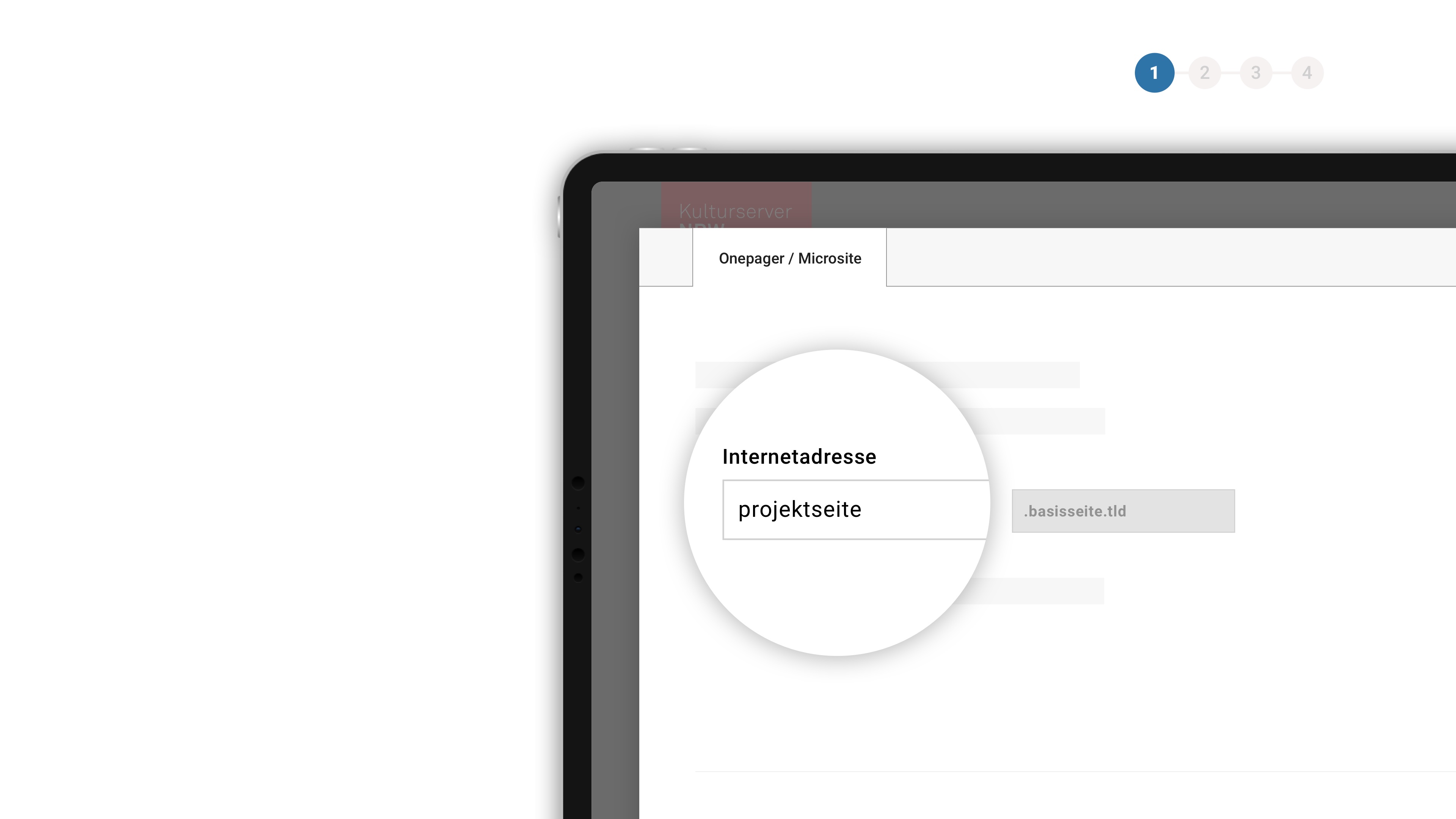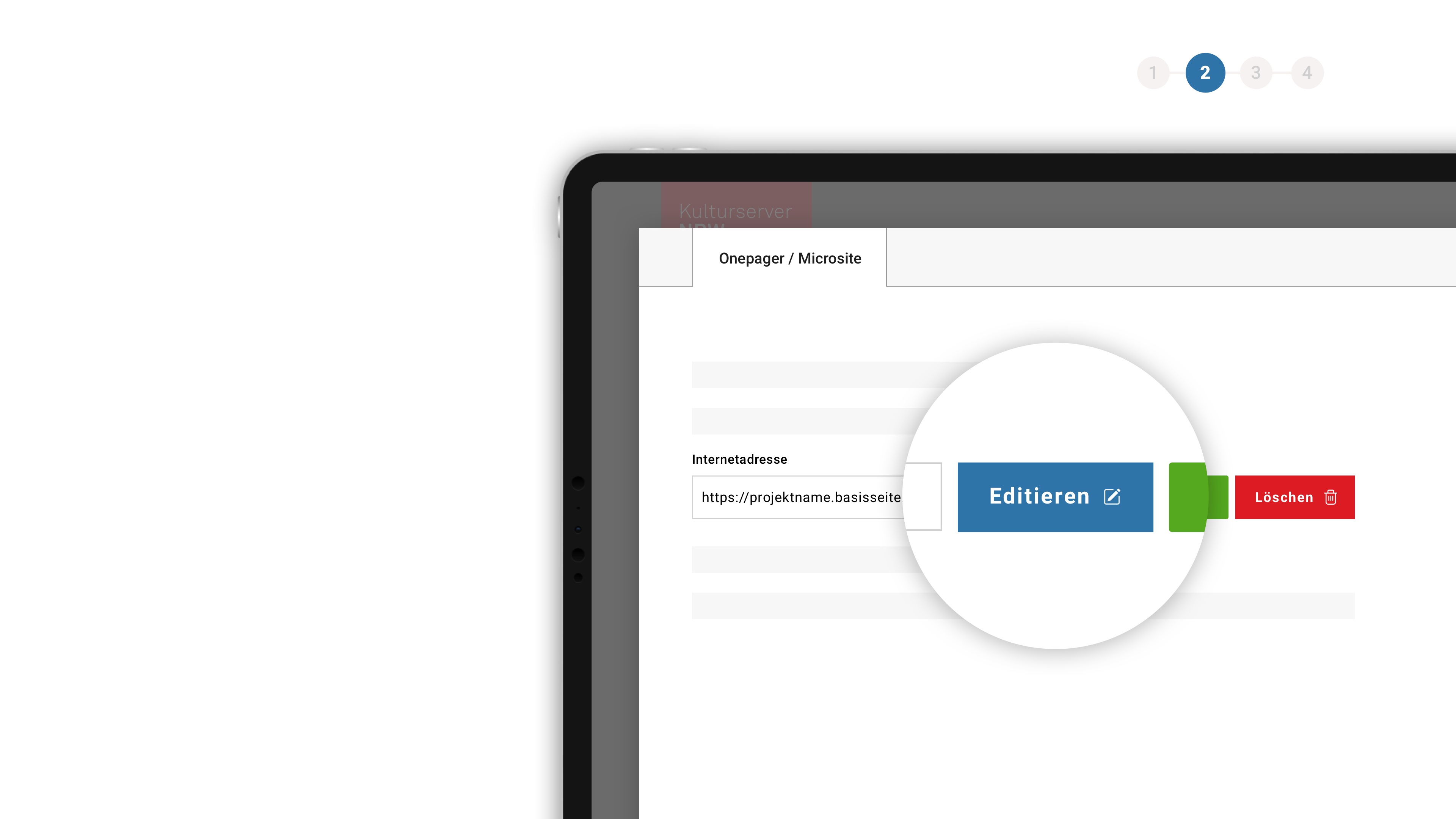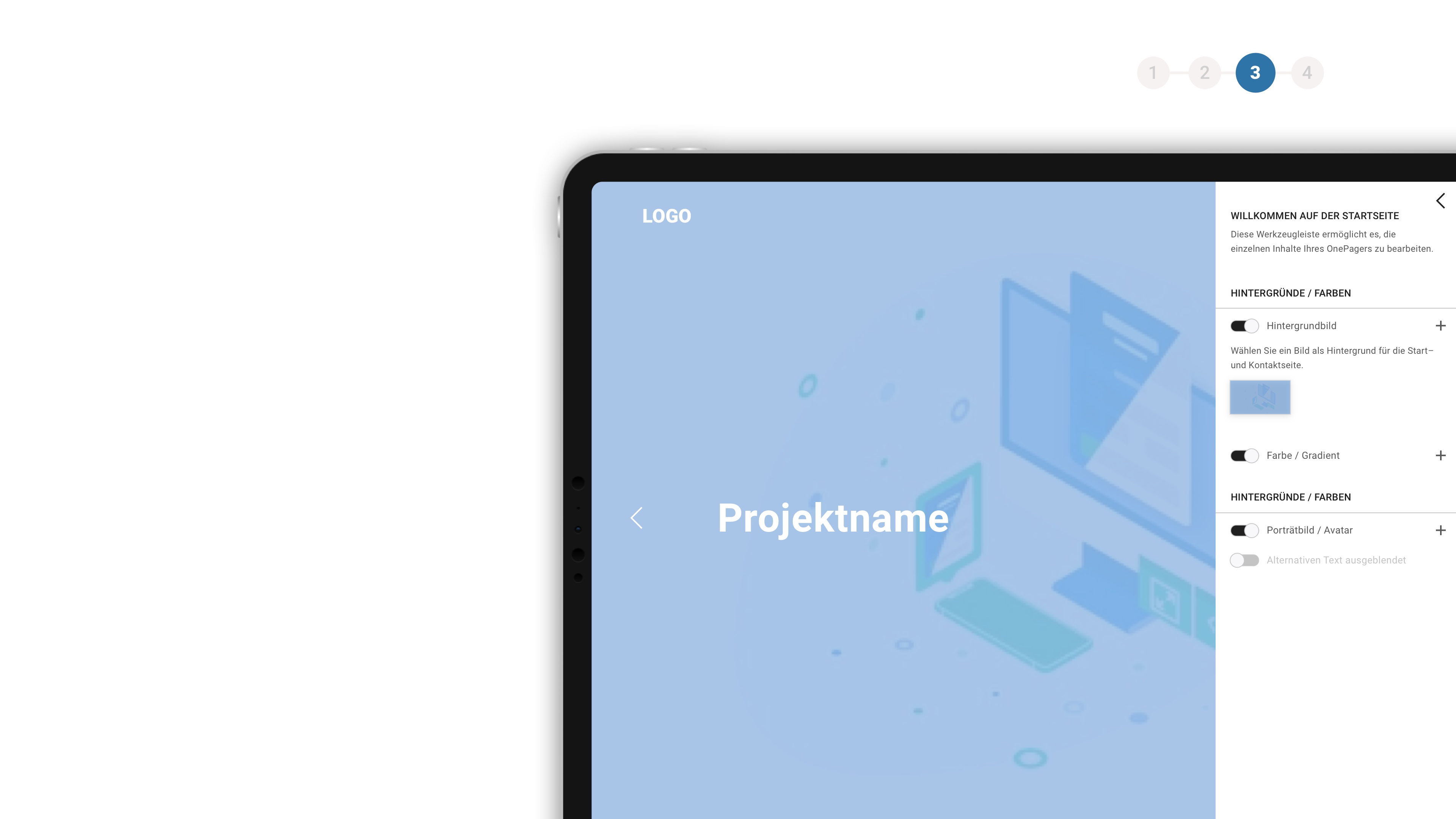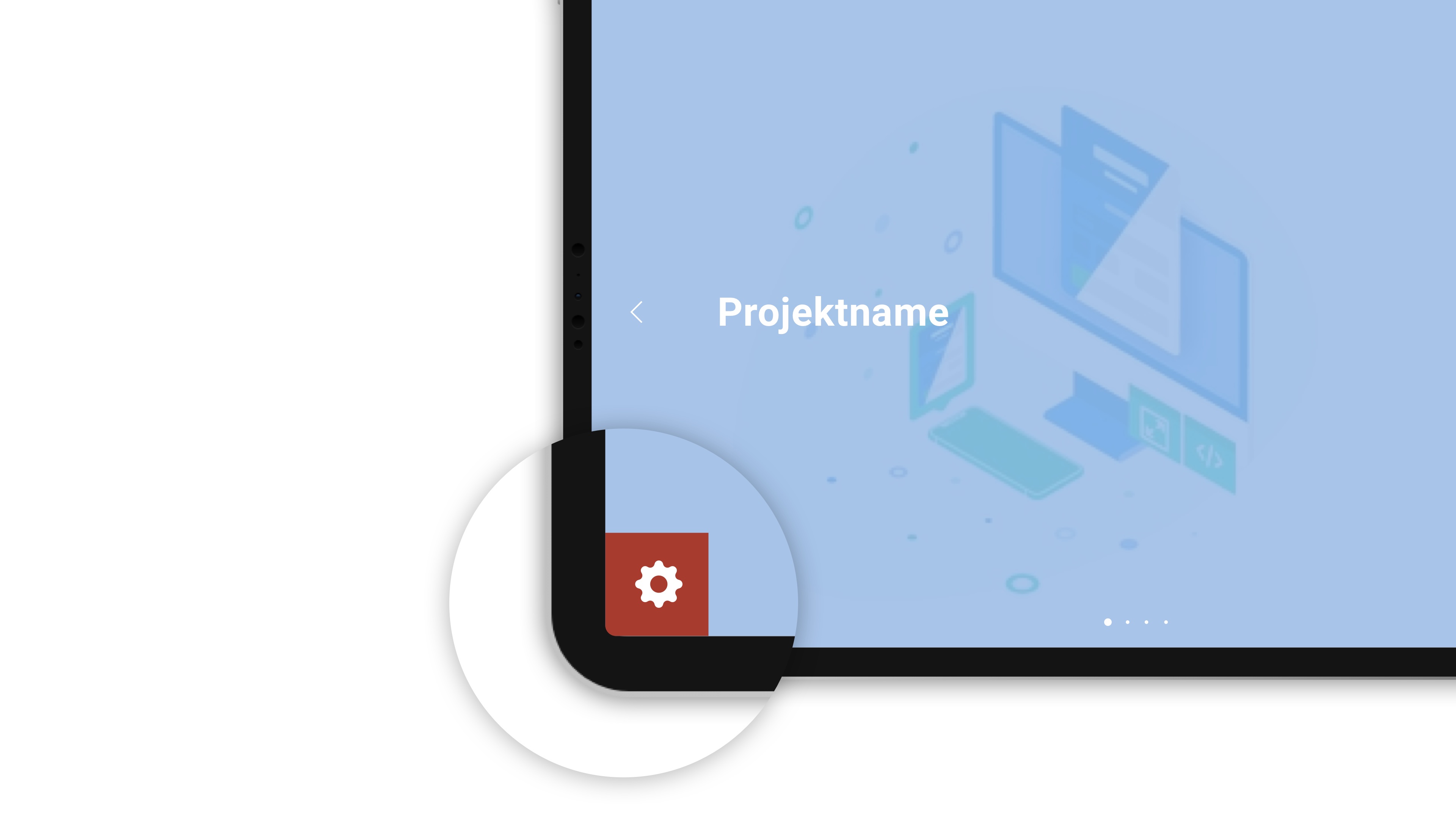Der Neuanfang vom Ende - Deutsche Oper Berlin
Der Neuanfang vom Ende
Stefan Herheim im Gespräch mit Jörg Königsdorf
Jörg Königsdorf: Das RHEINGOLD spielt in einer mythischen Vorzeit, die nicht von Menschen, sondern von Göttern und Zwergen bevölkert wird. Was bedeutet diese Vor-Zeit für uns?
Stefan Herheim: Schon der Titel suggeriert eine Zeit, in der das reine Gold noch unberührt im Flussbett ruht und die Natur intakt und heil ist. Dieses anfängliche Dasein unter Wasser antizipiert das noch nicht geborene Leben ebenso wie den Unschuldszustand vor dem Sündenfall und dem Rauswurf aus dem Paradies. Im knapp viereinhalbminütigen RHEINGOLD-Vorspiel wird anhand einer Naturtonreihe vom Ton „Es“ aus die Welt geschöpft – wie ein tönendes „Es war einmal…“. Wenige Minuten später gerät diese Welt aus den Fugen. Mit dem Raub des Rheingoldes und dem Schmieden des Rings fallen viele Schöpfungsmythen ineinander. Das Zeit- und Raumgefüge ist im RING nicht linear sondern kreisförmig, wodurch der zeitlose Mythos ebenso archaisch wie modern erscheint.
Jörg Königsdorf: Wir erleben zu Beginn der Inszenierung Menschen, die offenbar auf der Flucht sind und auf einer leeren Bühne innehalten. Was bringt sie dazu, hier quasi aus dem Nichts ein Spiel zu beginnen?
Stefan Herheim: Die Musik! Zunächst erklingt sie, weil das Opernhaus von einem Publikum mit entsprechenden Erwartungen betreten wurde. Die Töne beleben und rufen demgemäß zu einem kunstvollen Spiel auf, das sowohl auf der Bühne als auch im Zuschauerraum die Möglichkeit zur Flucht bietet. Wir wissen nicht genau, wovon die Menschen fliehen oder wohin sie flüchten, doch tragen sie alle ein „Nicht-Mehr“ und ein „Noch-Nicht“ mit und in sich, das mit einem „Es“ konfrontiert wird. Dieses schwillt als harmonischer Dreiklang aus dem Orchestergraben an und reizt das Kollektiv zu einem aus dieser Programm-Musik geborenen Bühnenspiel, das sich dann insofern verselbständigt, als dass die von ihrer Vorgeschichte Flüchtenden sich der Musik bemächtigen und ihre Geschichte neu gestalten.
Jörg Königsdorf: Neben dieser Masse spielender Menschen, verweist ein Konzertflügel auf der Bühne, der den Flüchtlingsstrom zunächst aufhält, auf das Werk als Produkt einer individuellen Imagination. Wie gehen diese beiden Ebenen zusammen?
Stefan Herheim: Der Flügel ist das Instrument, an dem Wagner den RING komponierte und Teile daraus erstmals der Öffentlichkeit präsentierte, an dem es zur Uraufführung probiert wurde und bis heute für jede Opernprobe als Orchesterersatz unverzichtbar ist. Der Flügel ist ein musikalisch-optisches Tor zur Phantasie und bleibt dennoch ein alltägliches Vehikel der im Moment zu schaffenden Kunst – ein Gebrauchsgegenstand des Opernalltags und ein heiliger Altar der künstlerischen Exekution zugleich. Dass die Spielenden vereinzelt das Klavier für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren, liegt in der Natur des Spiels, in dessen Bedeutungsfeld es szenisch eingespannt und ausgespielt wird.
Jörg Königsdorf: Ist der Rhein als Inbegriff einer harmonischen, sich selbst genügenden Natur eine irreale Wunschvorstellung eines Paradieses, das vielleicht nie existiert hat, oder ein Zustand, der tatsächlich realisierbar ist?
Stefan Herheim: Eines der wohl größten Probleme der Menschheit heute ist, dass sie sich so viele künstliche Bedürfnisse geschaffen hat. Ein Zusammenleben in einer Gesellschaft, der an wirklichen Bedürfnissen gelegen ist und wachsam in Harmonie mit ihrer Umgebung lebt, muss als erreichbares Ziel und nicht als Utopie gehandhabt werden. Am Ende des RINGs dämmern die Götter, nicht die Natur, und so bleibt die Frage, ob danach der Teufelskreis von vorne beginnt und Menschen sich wieder Götzen schaffen, oder ob diese Stufe der Evolution irgendwann überwunden sein wird. Das klangharmonische Paradies des Rheins ist ebenso wenig wie der Garten Eden ein wirklich erstrebenswerter Zustand. Also geht es nicht um eine naive Genügsamkeit, sondern um die Herausforderung, den aktiv fragenden und kreativ gestaltenden Menschen zu reflektieren, bis er die widersprüchlichen Impulse der Liebe heilsam annimmt und nutzt, um Wirklichkeit zu gestalten. Kunst ist ein Phänomen, bei dem es immer um ein „Weltschaffen“ geht – sowohl für die Wirklichkeit im Hier und Jetzt, als für die einer Zukunft. Dessen war sich Richard Wagner nicht nur bewusst, sondern er hat es zum Zentrum seines Denkens, Schaffens und Hoffens gemacht.
Jörg Königsdorf: Zentrale Figur des RHEINGOLDs ist der Nibelung Alberich, der Erfinder und erste Inhaber des Machtinstruments Ring. Vertritt er das Böse oder muss man die Figur komplexer sehen?
Stefan Herheim: Zwar schmiedet Alberich den Ring, doch erfindet er ihn nicht, sondern tut nur das, was die Rheintöchter ihm bewusst verraten, damit er in Versuchung gerät, den Sündenfall zu begehen: Das Gold lässt sich bezwingen, die Natur sich in Besitz nehmen und die Nibelungen sich unterjochen. Gerade das steht Wagners Liebesvorstellung konträr gegenüber, denn der knechtende Mensch bleibt selbst eine triebgesteuerte, erlösungsbedürftige Kreatur. Der durch die Nixen verhöhnte Alberich will seine Schmach kompensiert wissen, und so greift er aus machtloser Liebe zur lieblosen Macht. Gottvater Wotan hingegen, der einen Ast von der Weltesche abbrach und daraus den Speer schuf, um Gesetze zu hüten, die er selbst nicht befolgt, kämpft im Namen der Liebe, verliert dabei aber seine menschliche Göttlichkeit, bzw. göttliche Männlichkeit und ist schließlich von der erlösenden Weltentat einer Frau abhängig. Damit schließt sich der Kreis, denn das von Brünnhilde herbeigeführte Ende überlebt allein Alberich, der Schwarzalb. Er und Wotan, der Lichtalb, sind also nicht als Gegensätze von Gut und Böse zu verstehen. Vielmehr stehen sie wie Licht und Schatten in einer Abhängigkeit zueinander, die das Problem Macht und Liebe variieren.
Jörg Königsdorf: Im RHEINGOLD wird ja nicht nur ein Gegensatz von Kultur und Natur etabliert, sondern auch ein über Generationen dauernder Krieg zweier Familien. Sind diese Familien oder Sippen überhaupt als solche zu sehen? Oder stehen sie für Anderes?
Stefan Herheim: Die Götter, Riesen und Nibelungen können als Vertreter der Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts mit Aristokratie, Bürgertum und Proletariat gesehen werden. Schließlich haben wir es aber mit Archetypen zu tun, die man in fast allen Kulturen durch alle Zeiten hindurch findet. In unserer Inszenierung droht das ins kunstvolle Spiel flüchtende Kollektiv, durch Hochmut, Willkür, Neid, Wut, Standes- und Rassendünkel ebenso zu zerreißen, wie unsere Gesellschaft. Doch schließlich wird das Spiel von einer unzerbrechlichen Hoffnung auf eine Koexistenz aller miteinander getragen – im RHEINGOLD noch im Geiste einer göttlichen Komödie voller Doppeldeutigkeit und Ironie.
Jörg Königsdorf: In der Inszenierung gibt es auch einige Anklänge an die Zeit des Zweiten Weltkrieges: Ein Stahlhelm, die Gründgens-hafte Mephisto-Gestalt Loges, aber auch die Materialität der Koffer, die an Deportation und Vertreibung erinnern. Warum hakt sich die Inszenierung immer wieder an dieser Zeitspanne fest?
Stefan Herheim: Weil wir uns nicht in einem historischen Vakuum befinden, wenn wir an der Deutschen Oper Berlin Richard Wagners Hauptwerk zur Aufführung bringen. Der Vorwurf, solche Mittel wären längst abgegriffen, ist mir ebenso suspekt, wie die Forderung mancher Parlamentarier im heutigen Bundestag, über ein Kapitel deutscher Geschichte endlich hinwegzukommen, das erst ein Mannessalter zurückliegt, die Vernichtung ganzer Völker systematisierte, die zivilisierte Welt in Flammen steckte und sie für immer veränderte.
Jörg Königsdorf: Der RING wurde durchaus in weltverbessernder Absicht geschrieben: in der Hoffnung, dass sich die Menschen durch den Akt des Spiels, durch die Kunst läutern können. Gibt es zu dieser Hoffnung auch heute, fast 150 Jahre später noch Anlass? Oder ist die Kunst selbst schon zu sehr Teil des Systems?
Stefan Herheim: Natürlich ist die Kunst der Oper Teil jenes Systems, von dem sie subventioniert wird. An subversiven Elementen fehlt es ihr aber keineswegs, denn sie gibt dem Unerhörten und den Ungehörten eine Stimme, die das System als solches infrage stellt. Die politische Sprengkraft der Oper war immer maßgeblich für ihren Erfolg und wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Bestandteil ihres bildungspolitischen Auftrags. Heute ist es mühsam, sich auf diesen zu berufen, zumal das System selbst eine Werte- und Identitätskrise durchläuft, die uns selbst zwischen ein „Nicht-Mehr“ und „Noch-Nicht“ auf der Schwelle setzt. Um so mehr glaube ich, dass die Kunst des Spiels, wie sie uns im RING vorgeführt wird, Leitfaden, Korrektiv und Inspiration sein kann. Die liebeserlösenden Klänge am Ende der GÖTTERDÄMMERUNG feiern schließlich nicht das fatale Scheitern, sondern evozieren den Hoffnungsschimmer eines Neuanfangs.