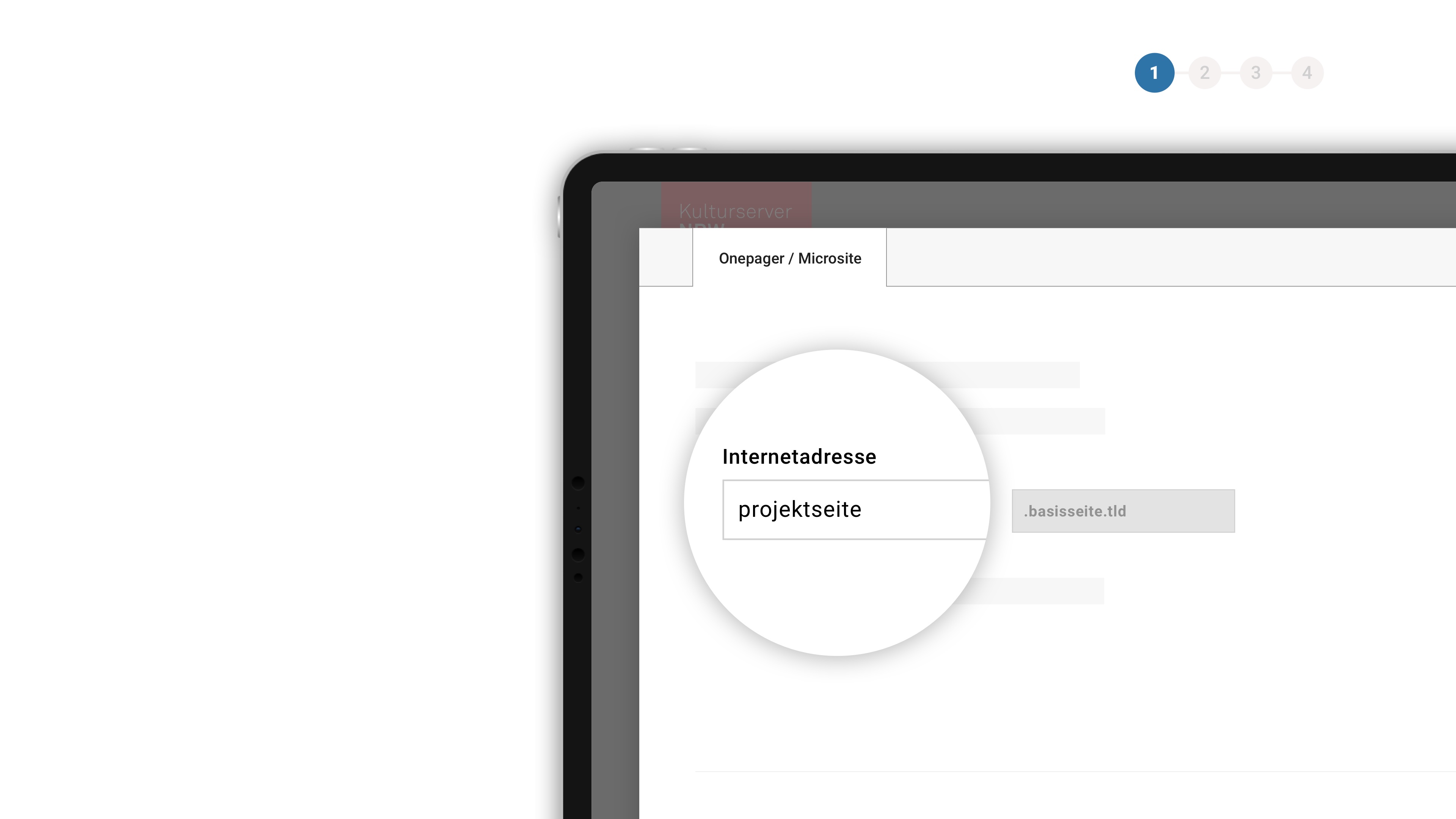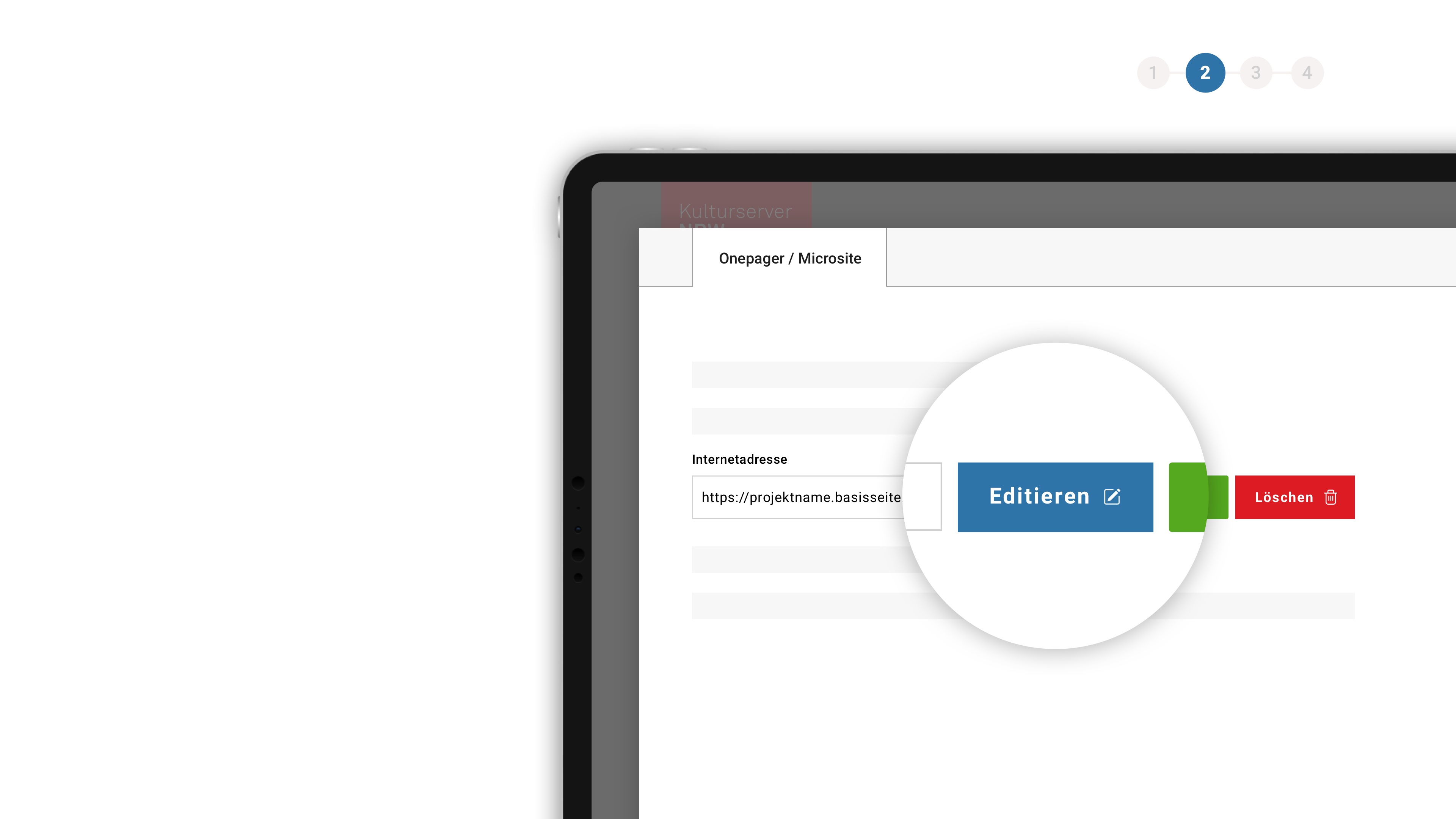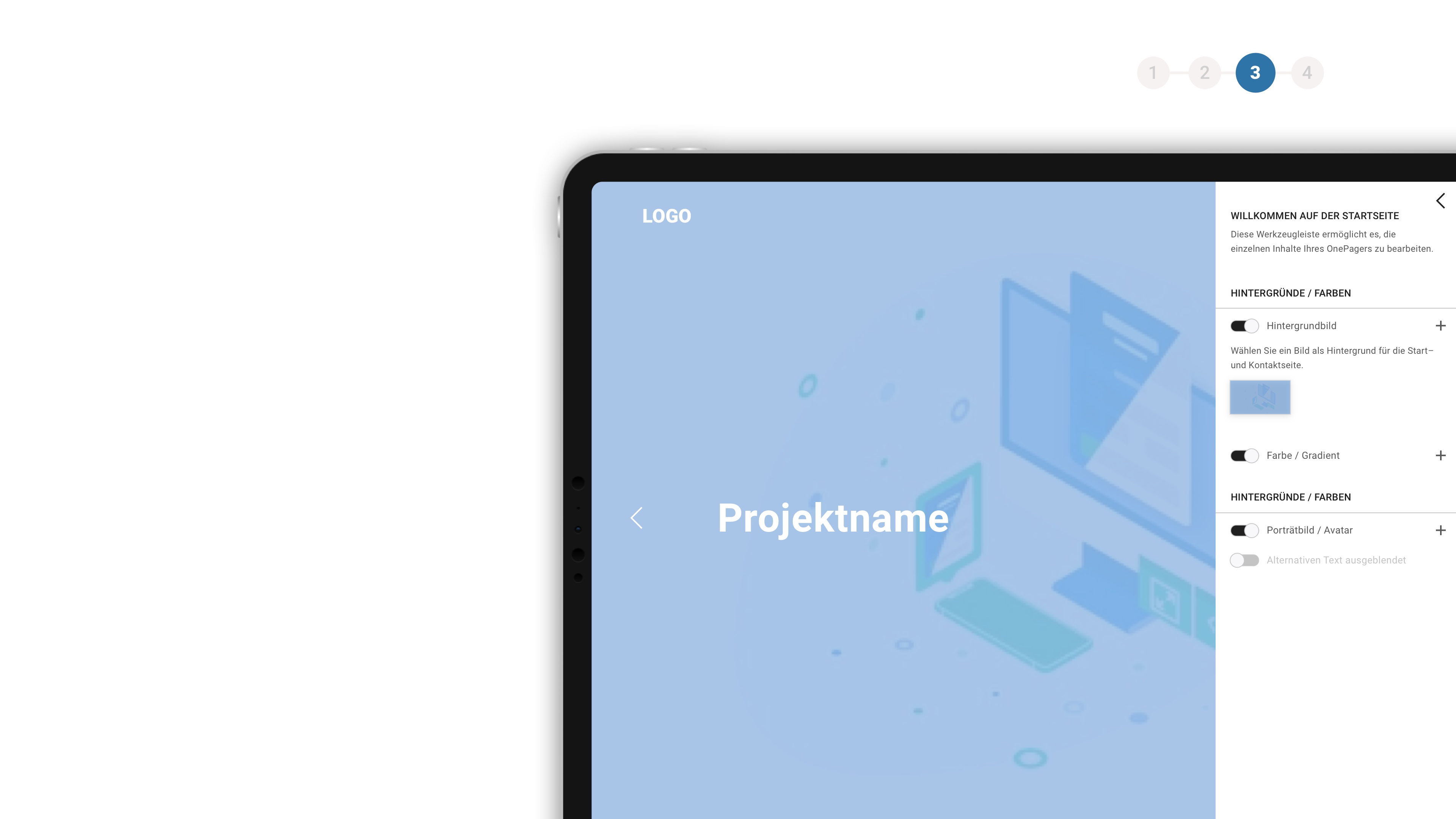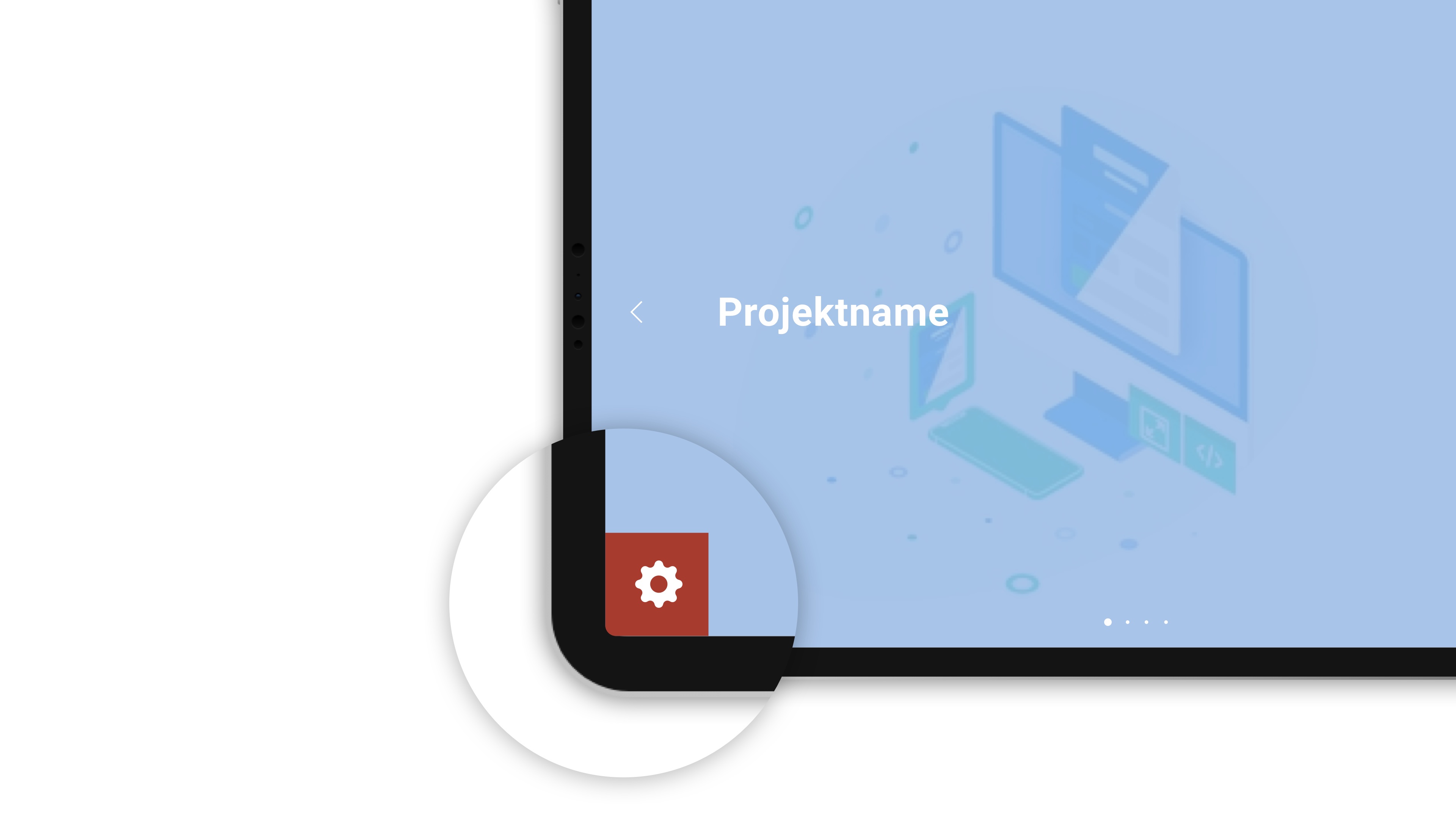Die Entzauberung einer Märchenwelt - Deutsche Oper Berlin
Die Entzauberung einer Märchenwelt
Tobias Kratzer im Gespräch mit Jörg Königsdorf
Jörg Königsdorf: An ihrer Erzähloberfläche ist DIE FRAU OHNE SCHATTEN ein Märchen. Wie beeinflusst diese Form die Inszenierung?
Tobias Kratzer: Das Stück hat vor allem eine Aufführungspraxis, die eher die märchenhaften Aspekte in den Vordergrund stellt oder deren tiefenpsychologische Deutung, aber weniger eine konkrete, auch soziale Erkundung der zentralen Figuren. Im Kern finde ich das Stück aber gar nicht so märchenhaft: Wenn man versucht, alle Geister, sprechenden Tiere und magischen Stimmen erstmal beiseite zu lassen, dann ist es eigentlich ein sehr präzises, analytisches Stück. Im Kern steht die realistische Beschreibung von fünf Menschen, die sehr nachvollziehbare Probleme haben. Mir geht es darum, diese Seite des Werks in den Mittelpunkt zu stellen, umso mehr, als ich bei Aufführungen der FRAU OHNE SCHATTEN oft das Gefühl habe, dass man meist ab Mitte des zweiten Aktes den Überblick verliert – dabei bleibt die Erzählung bis zum Ende eigentlich sehr präzis. Und das will ich zeigen. Im Rahmen einer Konkretisierung des Werks werden bei uns Märchenfiguren wie Falke und Gazelle als psychologische Metaphern aufgelöst im Sinne einer Erzählung, die ohne äußere Magie auskommt. Alles hat hier unmittelbar mit dem Beziehungsleben, den psychologischen Profilen und Konfliktlagen der Hauptfiguren zu tun.
Jörg Königsdorf: Bis hin zu den Fischen, die von der Amme herbeigezaubert werden.
Tobias Kratzer: Genau. Selbst diese Szene wird bei uns auf eine sehr konkrete Weise aufgelöst, die unmittelbar auf das Thema des Kinderwunsches verweist. Mir ist aber wichtig zu betonen, dass diese „Entzauberung“ eher eine Intensivierung meint, als solche aber nicht nur einzelne Elemente, sondern auch die Spielvorgänge auf der Bühne insgesamt betrifft. Es gibt nur offene Verwandlungen, das heißt, alle Wechsel der Szene werden, nicht anders als die Figurenprofile, vor dem Publikum komplett offengelegt und bekommen dadurch eine andere Art von magischer Theatralität, nämlich keine, die Vorgänge verschleiert und dekoriert, sondern eine, die ihre eigenen Mittel offenlegt. Man sieht das Stück oft flirrend, bunt und überausgestattet, aber ich habe das Gefühl, dass das Potenzial der Musik sogar stärker entfaltet wird, wenn man szenisch nicht tautologisch mit dem Stück umgeht. Im ersten Akt stehen die beiden Welten von Kaiser- und Färberehepaar einander antipodisch und geschlossen gegenüber. Im zweiten Akt, dessen Dramaturgie viel sprunghafter ist und in dem die beiden Welten einander überlappen, werden die zentralen Elemente beider Sphären folgerichtig zu einer Art Simultanbühne verknüpft. Im dritten Akt, wo die Hauptfiguren auf Tour durch eine magische Unterwelt gehen, schicke ich sie nicht durch geisterhafte Katakomben, sondern konfrontiere sie mit sehr konkreten Situationen und Räumen des Beziehungslebens – auch des Nachwuchses: eine Paartherapie, eine Klinik, eine Baby Shower Party, die in einer schnellen Folge unterschiedliche Etappen darstellen, statt einen verwunschenen Raum zu öffnen.
Jörg Königsdorf: Das Märchenhafte ist also eher ein funkelnder Schleier, den die Musik über die Realität wirft?
Tobias Kratzer: Wobei es aus meiner Sicht ein Missverständnis wäre, die Musik nur als äußere Schauseite aufzufassen. Gerade dann, wenn die Szene das Märchenhafte nicht eigens betont, wird die extreme Beschreibungskraft von Strauss’ Musik für innere Konflikte kenntlich.
Jörg Königsdorf: Das Stück entstand in einer Zeit extremer gesellschaftlicher Umwälzungen. Inwiefern spielt das in diese Sichtweise hinein?
Tobias Kratzer: Man muss natürlich erstmal verstehen, woher das Werk kommt und dass die gesellschaftlichen Umwertungen infolge des Ersten Weltkriegs hier – anders als bei ARABELLA – eher als reaktionäre Gegenbewegung Form gewinnen, als dass hier die Speerspitze einer gesellschaftlichen Avantgarde formuliert würde. Das ist eine historische Analyse, die ich zur Kenntnis nehme, wie in den beiden anderen Werken unseres Strauss-Zyklus. Mir geht es jedoch nicht primär um eine Auseinandersetzung mit diesem historischen Kontext. Im Zentrum des ganzen Zyklus steht ja der Nachweis der Anschlussfähigkeit von Strauss’ Werk an heutige Debatten. Natürlich hat das Werk Entstehungsbedingungen, aber es heute aufzuführen rechtfertigt sich erst durch seine Gegenwärtigkeit. Dabei fließen in DIE FRAU OHNE SCHATTEN die Erfahrungen, die ich mit ARABELLA und INTERMEZZO gemacht habe, natürlich mit ein. Das betrifft eine Sensibilität für die Aspekte, wo Strauss vielleicht gegen sein eigenes Wollen seismografisch gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen ist – und entgegen dem, was ihm oft auch unterstellt wird, auch ironischer.
Jörg Königsdorf: DIE FRAU OHNE SCHATTEN hat den Anspruch, ihrer Gegenwart eine humanistische Botschaft zu vermitteln. Gleichzeitig tritt aber die Gesellschaft selbst – beispielsweise als Chor – gar nicht in Erscheinung. Wie geht das zusammen?
Tobias Kratzer: Es geht durchaus zusammen, weil ja oft das Allerprivateste das Allerpolitischste ist und auch die Message des Stücks, die natürlich schon deshalb nicht einfach zu benennen ist, weil Strauss und Hofmannsthal hier, wenn auch nicht so stark wie in ARABELLA, auseinandergehen. Wenn man beispielsweise die Erzählung Hofmannsthals nimmt, ist für ihn die Begegnung der Kaiserin mit Barak entscheidend, die aber im Libretto mit sehr wenigen Worten auskommt. Eine Botschaft gegenseitiger Empathie, die sagt, dass Menschen auch aus völlig unterschiedlichen Milieus mit stark differierenden Lebensvorstellungen einander begreifen können, selbst wenn es gegenläufige Interessen gibt. Das ist sehr zentral und eine Botschaft, die man von der kleinsten Mikrozelle in Familie und Freundeskreis bis hin zum Verhältnis zwischen Staaten hochrechnen kann. Der zweite Aspekt der Botschaft, dass Kinder zu zeugen die einzig selig machende Menschheitslösung ist, ist aus gegenwärtiger Sicht deutlich schwieriger, weil es heute viel unterschiedlichere Lebensentwürfe gibt. Ich würde das Glückspotenzial des Kinderkriegens gar nicht negieren wollen, aber das Spektrum des individuell und gesellschaftlich Gutgeheißenen hat heute doch eine wesentlich größere Spannbreite und Liberalität.
Jörg Königsdorf: Die Form des Märchens liefert in der FRAU OHNE SCHATTEN zunächst relativ einfache Charaktere, was auch durch die markanten, ihnen zugeordneten Motive unterstrichen wird. Inwiefern kann da von einer Entwicklung im psychologischen Sinn die Rede sein?
Tobias Kratzer: So einfach sind die Figuren für mich nicht. Ich finde sie schon am Anfang präzise beschrieben, so dass jedermann einsteigen kann, aber jeder Charakter, vor allem Kaiserin und Färberin, macht eine extreme Entwicklung durch. Sogar die Amme, die ja manchmal auf ein hexenhaft-mephistophelisches Auftreten beschränkt bleibt. Am Anfang hält man sie für eine kühle, unemotionale, nur instrumentell denkende Frau. Am Ende, wenn sich die Kaiserin von ihr lossagt, wird jedoch klar, dass da auch ein liebendes Herz voller Verwundungen schlägt. Verwundungen, deren Vorgeschichte wir nie erfahren, die aber dennoch spürbar sind. Selbst sie kann den kalten Blick auf die Menschen nicht aufrecht erhalten, den wir zu Beginn an ihr wahrnehmen, weil es eben doch in jedem Menschen einen Restbestand an Geliebtwerdenwollen gibt – auch wenn die Amme selbst das vermutlich weit von sich weisen würde. Natürlich ist das märchenhaft Schematische den Figuren bis zu einem gewissen Grad inhärent, aber die Musik spricht oft eine andere Sprache und zeigt eine Entwicklung. Das versuche ich eher zu verstärken, so dass jedes Paar sich zu einer Lösung durcharbeitet, die für dieses Paar sinnvoll ist. So dass nicht die prästabilisierte Harmonie der vier, die im Finale des dritten Akts aufgerufen wird, der Weisheit letzter Schluss ist. Da finde ich das Stück, in dem, was es bis zum Quartett aufreißt, gewagter als den Versuch, am Ende die Fäden wieder einzuholen.
Jörg Königsdorf: Einer Figur wird für ihren Entwicklungsprozess besonders viel Raum gegeben: Die Kaiserin hat in der Mitte des Stücks einen Traum, in dem ihr bewusst wird, dass sie Barak nicht um ihres Mannes willen im Stich lassen will. Ist das der Wendepunkt des Stücks?
Tobias Kratzer: Zunächst einmal ist es der Wendepunkt der Kaiserin. Ob es auch derjenige des Stückes ist, ist schwierig zu sagen, denn der dritte Akt arbeitet ja dann nochmals die Dinge durch, die im zweiten Akt angerissen wurden – eine sehr eigenwillige Dramaturgie. Für mich liegt der Wendepunkt des Stücks wohl doch eher im Finale des zweiten Aktes, weil hier durch das Eingreifen höherer Mächte deutlich wird, dass der Versuch dieser fünf Figuren, Elternschaft zu kontrollieren oder sich herbeizuwünschen, eines der letzten Felder ist, das sich der kompletten menschlichen Einflussnahme entzieht, weil dort so viele genetische, medizinische Kontingenzen mitwirken. Auch das ist eine Einsicht. Aber vielleicht macht jeder im Stück seinen eigenen Wendepunkt durch: Färber und Färberin etwa im dritten Akt, wenn sie feststellen, dass sie vielleicht, in ihrer konfliktreichen Liebe doch nicht so zueinander passen, wie sie es gedacht hatten – eine im Übrigen eher opernuntypische Erkenntnis, weil man als Paar ja sonst entweder in der Ehe oder in Mord und Totschlag endet. Dass man auch zu so einer Lösung kommen kann, sehe ich als eine sehr humanistische Möglichkeit des Stücks. Bei Kaiser und Kaiserin hin[1]gegen ist die Befreiung von der patriarchalen Macht des Keikobad auch ein ganz wichtiger Punkt, der erst im dritten Akt stattfindet. Vor allem für die Kaiserin ist die Auflehnung gegen den Vater letztlich noch wichtiger als die Empathie gegenüber Barak: Ihr Entschluss, ihn direkt herauszufordern und sich gegen ihn aufzulehnen und nicht seine durch ominöse Boten überbrachten Ultimaten als gesetzt anzusehen, ist ihr letzter Entwicklungsschritt, der erst ermöglicht, dass sie und der Kaiser wieder aufeinander zugehen. Das Motiv der Erstarrung des Kaisers ist ja auch eher ein psychologisches als ein materielles.
Jörg Königsdorf: Die Kaiserin ist die einzige Figur, die uns in einem Eltern-Kind-Zusammenhang begegnet. Heißt das, dass sie in der Tradition verhaftet ist?
Tobias Kratzer: Sie steht jedenfalls in patriarchalischen Familienzusammenhängen, in denen es eine sehr klare Vorstellung von dynastischen Abfolgen gibt. Das wird ja auch dadurch aufgerufen, dass sie den Vergleich zwischen ihrem Vater und König Salomo zieht – da wird die biblische Genealogie ins Irdische gewandt.
Jörg Königsdorf: Ist ihr Kinderwunsch mithin Folge der Erwartungshaltung ihres Vaters?
Tobias Kratzer: Ich weiß nicht, ob es hier eine monokausale Erklärung gibt. Ein Kinderwunsch kann ja viele Gründe haben, bewusste, unbewusste, innerfamiliäre. Die Kaiserin muss sich im Stück überhaupt erstmal darüber klarwerden, ob ihr Kinderwunsch ein eigener ist oder eine internalisierte gesellschaftliche Forderung. Ist dieser Kinderwunsch ein alle anderen Wünsche – wie etwa auch den nach einer glücklichen Beziehung übertönender Wunsch? Am Anfang des Stücks ist die Kaiserin in einem Zustand, in dem sie diesen Wunsch gar nicht hinterfragt. Für sie gehören Kinder erstmal einfach zu einer glücklichen Ehe dazu – dass das gar nicht so sein muss, dass andere Lebensentwürfe auch ihr Eigenrecht haben, das muss sie erstmal begreifen und genau das führt ihr der Weg durch die Menschenwelt vor Augen. Ich glaube auch, dass die Kaiserin nach drei Akten noch nicht am Ende dieses Prozesses ist.
Jörg Königsdorf: Im Gegensatz zur Kaiserin erscheint die Färberin zunächst als eher negativ gezeichnete Figur, auch musikalisch: Strauss charakterisiert sie mit einem keifigen Motiv, das geradezu das Gegenteil des phlegmatisch behaglichen Barak-Motivs ist. Und wenn man weiß, dass Strauss nach Hofmannsthals Rat die Färberin nach dem Muster seiner Frau modellierte, wird sie auch nicht sympathischer.
Tobias Kratzer: Das rückt DIE FRAU OHNE SCHATTEN aber noch näher an INTERMEZZO heran. Dort bringt er seine Frau etwas unverhohlen auf die Bühne. Mit der Färberin haben wir lediglich eine stärkere Form der künstlerischen Verarbeitung vor uns.
Jörg Königsdorf: Anders als bei der Kaiserin gibt Strauss der Färberin nur sehr wenig Raum für den persönlichen Läuterungsprozess.
Tobias Kratzer: Trotzdem ist das Publikum meiner Erfahrung nach sehr stark bei ihr, da sie die nachvollziehbarsten Konflikte hat. Das Grundgütige von Barak, der sich jeglichen Auseinandersetzungen zu entziehen versucht, kann einem ja auch schnell auf die Nerven gehen. Natürlich ist er nobel gezeichnet und am Ende eine sehr sympathische Gestalt. Aber oft tendiert das Gute bei ihm zum Phlegmatischen und das Aggressionspotenzial der Färberin ist nicht zuletzt ein Schrei nach Liebe. Darüber hinaus ist sie in diesem Stück auch körperlich am stärksten betroffen: Alle versuchen über sie zu verfügen – egal, ob mit Mitteln des Geldes oder mit Mitteln des ehelichen Rechtes, sanft wie Barak oder strategisch wie die Amme. Dem Profil dieser Frau sind insofern eine Form von Selbstbehauptung und die Notwendigkeit, das Recht an ihrem eigenen Körper zu behalten, eingeschrieben. Es geht hier um das Selbstbestimmungsrecht einer nicht besonders reichen Frau, die zudem in ihrer Ehe vermutlich sehr stark von ihrem Mann abhängig ist. Das sind Konfliktfelder, die noch das gesamte 20. Jahrhundert und wahrscheinlich auch das 21. Jahrhundert prägen. Die Färberin ist eine Figur, in deren Körperdiskurs sich, obwohl nicht so symbolisch überhöht wie bei der Kaiserin, viel größere Diskurse ablesen lassen.
Jörg Königsdorf: Beim Kaiser hingegen fragt man sich, inwieweit da von psychischem Tiefgang die Rede sein kann. In seinem sexuellen Erlebnishunger wird er uns eher als Playboy vor Augen geführt.
Tobias Kratzer: Trotzdem hat er dann seine große Szene im zweiten Akt, die ein wenig mysteriös ist, weil er plötzlich kurz davor ist, seine Frau zu töten und dem Falken nachzulaufen. Auch hier ist ein großer Diskurs von verletzter und toxischer, aber auch unsicherer Männlichkeit enthalten. Ähnlich wie die Kaiserin scheint er daran zu verzweifeln, dass seine Ehe kinderlos ist. Im Strauss’schen Weltbild ist das zwar allein die Schuld der Frau, aber wenn man das 2025 aktualisiert, ist das erstens keine Schuldfrage und zweitens ist die Ursächlichkeit in beiden Teilen einer Beziehung zu suchen. Ich glaube, der Kaiser leidet massiv daran, dass die Leichtigkeit der Beziehung zu seiner Frau verloren gegangen ist. Die Selbstverständlichkeit, die Leidenschaft, für die das Auftreten des Falken steht, ist fort. Ich nutze diese Szene, um die Verzweiflung des Kaisers zu zeigen, auch sein toxisches Verhalten, sich Bestätigung anderswo zu suchen. Im Vorspiel seiner Arie reist er durch die Nacht und versucht, sein Selbstbewusstsein mit Affären wieder aufzupolieren. Wenn er zu seiner Frau zurückkehrt, steht sich ein entfremdetes Paar in einer Art Zimmerschlacht gegenüber. Das ist eine psychologisch sehr tiefgreifende Szene, in der die beiden eigentlich gerne wieder zueinander kommen und zu einer sozusagen unschuldigen Leidenschaftlichkeit zurückkehren wollen. Das klappt aber nicht mehr und sie sind von intimsten Freunden fast zu äußeren Feinden geworden, ohne das zu wollen. Das ist etwas, wo sich in des Kaisers Not und in seinen Taten eine große Krise, nicht nur eine Beziehungskrise, sondern auch eine Krise seiner Männlichkeit abzeichnet.
Jörg Königsdorf: In Bezug auf die Färberin war schon von den sozialen Unterschieden die Rede, die das Stück abbildet. Welche Rolle spielt diese soziale Komponente darüber hinaus?
Tobias Kratzer: Eine immense. DIE FRAU OHNE SCHATTEN ist ein Stück über Klassismus. Es wird immer von der hohen Geisterwelt und der niederen Menschenwelt gesprochen und ich überführe das in eine Zwei-Klassen-Welt, in der entscheidend ist, dass Kaiserin und Kaiser eine finanzielle Verfügungsgewalt haben, die es ihnen ermöglicht, über den Körper einer Frau der niederen Klasse zu verfügen. Nicht im Sinne eines Sklavenverhältnisses, aber dort, wo die Färberin verführbar wird, also über Kauf und Preis gesprochen wird, wird klar, dass es sich um eine wenngleich indirekte Machtausübung handelt. Damit geht eine hohe moralische Verantwortung einher, derer sich die Kaiserin zu Beginn noch gar nicht bewusst ist. Die Amme spricht viel von Preis und Kauf, die Kaiserin hinterfragt das zunächst nicht. Aber der Akt ihrer Bewusstwerdung bezieht sich natürlich auch darauf, dass sie diesen Zusammenhang erkennt und daraus das eigene Handeln ableitet.
Jörg Königsdorf: Die Leihmutterschaft wird von der Kaiserin schließlich abgelehnt. Ist das auch das moralische Votum der Produktion?
Tobias Kratzer: Erstmal entscheidet die Kaiserin sich bewusst dafür, eine Leihmutterschaft in Anspruch zu nehmen. Erst als sie merkt, was diese Entscheidung beim Mann der Leihmutter auslöst, der diese Entscheidung nicht mitgetragen hat, wird ihr der eigene moralische Zwiespalt bewusst. Mir ist wichtig, dass die Inszenierung das in einer offenen Dialektik hält, weil ich das weder moralisch verurteilen noch rückhaltlos befürworten will. Leihmutterschaft ist ein Akt des Austausches, der vielen Menschen viel Glück ermöglicht, andererseits aber viele ethische und moralische Fragestellungen aufwirft. Und ich glaube, das merkt die Kaiserin: Als ihr klar wird, dass das nicht abgesprochen ist, versucht sie das Ganze zu stoppen. Aber die Befruchtung der Färberin hat da schon stattgefunden.
Jörg Königsdorf: Gilt die Anschlussfähigkeit an moderne Diskurse, die im Zentrum dieses Strauss-Zyklus steht, eigentlich auch für die anderen Strauss-Opern?
Tobias Kratzer: Ich glaube nicht, dass man alle Strauss-Stücke in die Reihe unseres Zyklus einordnen könnte – sowohl die späten wie die frühen sind da deutlich anders. Bei ARABELLA, INTERMEZZO und DIE FRAU OHNE SCHATTEN ist die zyklische Komponente für mich extrem triftig, weil man mit ARABELLA auf den Widerspruch im Denken von Hofmannsthal und Strauss hinweisen und dabei zugleich sehr gegenwartsfähige Problematiken – in diesem Fall das Transgenderthema – aufzeigen konnte. Dann hat sich für mich INTERMEZZO tatsächlich als ein Schlüsselstück für das Verständnis von Strauss‘ Schaffen gezeigt – ähnlich wie AGRIPPINA für Händels Opern: Ein Werk, das einem einen Schlüssel für das an die Hand gibt, was in den übrigen Stücken auch vorhanden ist, aber weniger klar hervortritt: Pathos, Humor, Ironie, Ernsthaftigkeit. Das ist bei Händel manchmal nicht einfach zu entscheiden und bei Strauss ebenso: Man fragt sich, wann zum Beispiel die Überinstrumentierung als Selbstparodie gemeint ist, und wo sie der Intensivierung einer Emphase dienen soll. Das ist gerade beim späteren Strauss oft gar nicht so trennscharf und für mich war INTERMEZZO ein Schlüsselstück für einen leichteren, spielerischen, selbstdistanzierteren, wenn man es zugespitzt sagen will: fast schon brechtschen Zugang. Dieser Blickwinkel hat dann auch meine Sicht auf DIE FRAU OHNE SCHATTEN mitgeprägt: das Stück nicht von SALOME und ROSENKAVALIER her, sondern von den späteren, selbstreflexiveren Werken her zu denken. Um aber auf die Frage zurückzukommen: Bei den späten Strauss-Opern befinden wir uns mit jedem Werk dann doch in einem eigenen Kosmos: DIE SCHWEIGSAME FRAU hat eine spezielle Komödienform als well made play und die darauffolgenden Opern sind dann wieder von den geänderten Zeitläuften geprägt. In unserem Zyklus haben wir bei ARABELLA die Historizität des Stücks durchgearbeitet, indem wir den Bogen von 1860 bis ins heute geschlagen haben und in einem weißen Raum angekommen sind. Von diesem gegenwärtigen, zeitlosen Raum aus hatte ich das Gefühl, die beiden folgenden Opern des Zyklus als Entwürfe gegenwärtiger Konfliktlagen behandeln zu können. Bei den späteren Werken wie CAPRICCIO und DAPHNE, die im Kontext des Nationalsozialismus entstanden sind, fände ich den Verzicht auf den historischen Kontext zugunsten einer Gegenwärtigkeit problematischer.
Jörg Königsdorf: Vollzieht DIE FRAU OHNE SCHATTEN nicht in einer Hinsicht doch einen Paradigmenwechsel in Richtung Moderne? In der Oper des 19. Jahrhunderts lieben einander ja in der Regel Menschen, die musikalisch zusammenpassen und auch bei tragischem Ausgang füreinander bestimmt scheinen. Hier ist die Situation hingegen viel offener, die Botschaft ist eher: Man passt eh nie perfekt zusammen, entweder man arbeitet daran oder man sucht etwas anderes.
Tobias Kratzer: DIE FRAU OHNE SCHATTEN markiert schon in gewisser Weise eine Abkehr von einem romantischen Liebesideal, indem sie Beziehungen auf Zeit oder pragmatische Beziehungen oder Beziehungen mit Benefits zwar angesichts des konservativ ausgerichteten Finales nicht gleichberechtigt nebeneinanderstellt, aber zumindest in seinem Verlauf all diese Möglichkeiten aufruft. Und das tun wenige Opern dieser Zeit und dieses Kalibers.