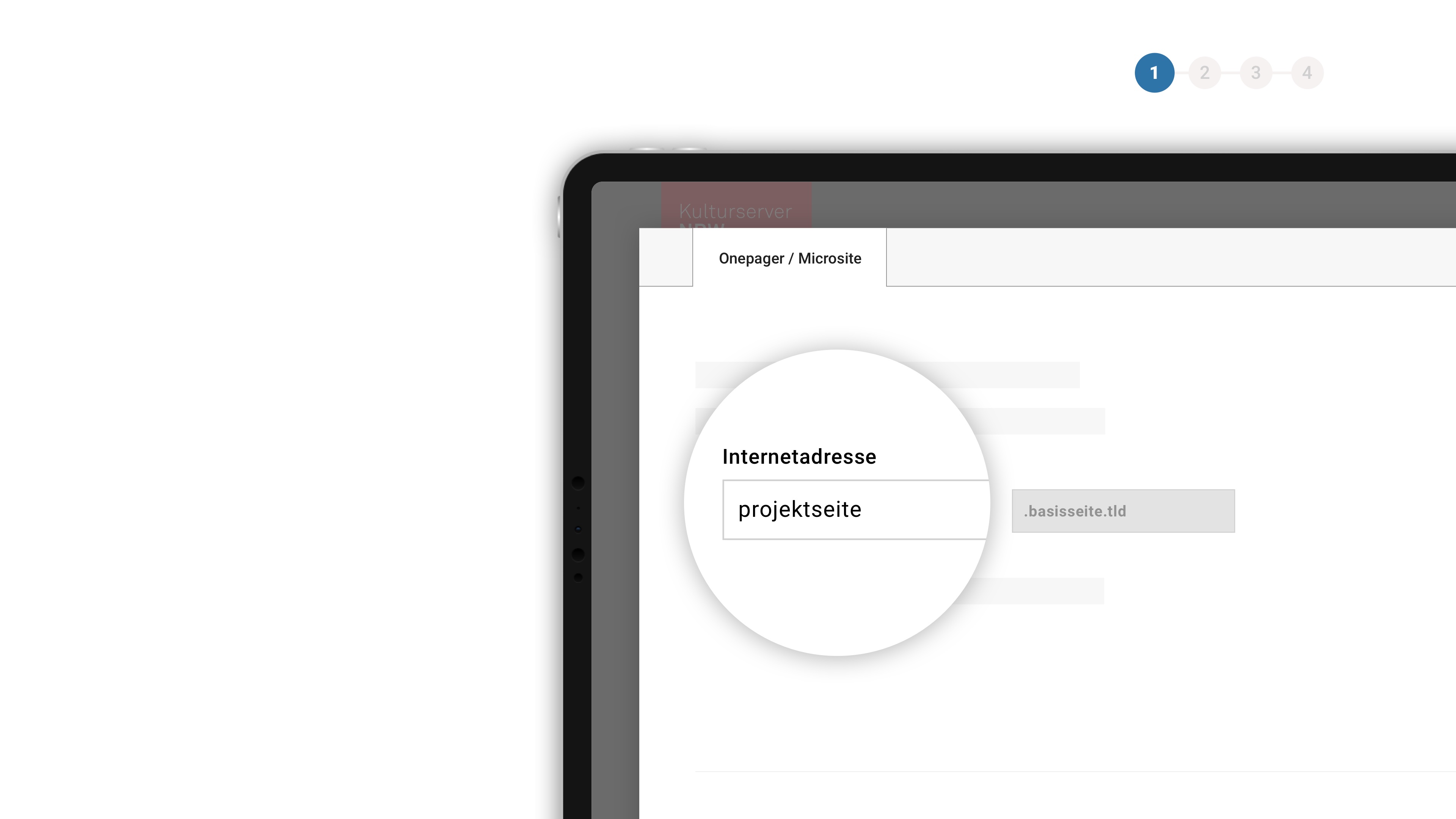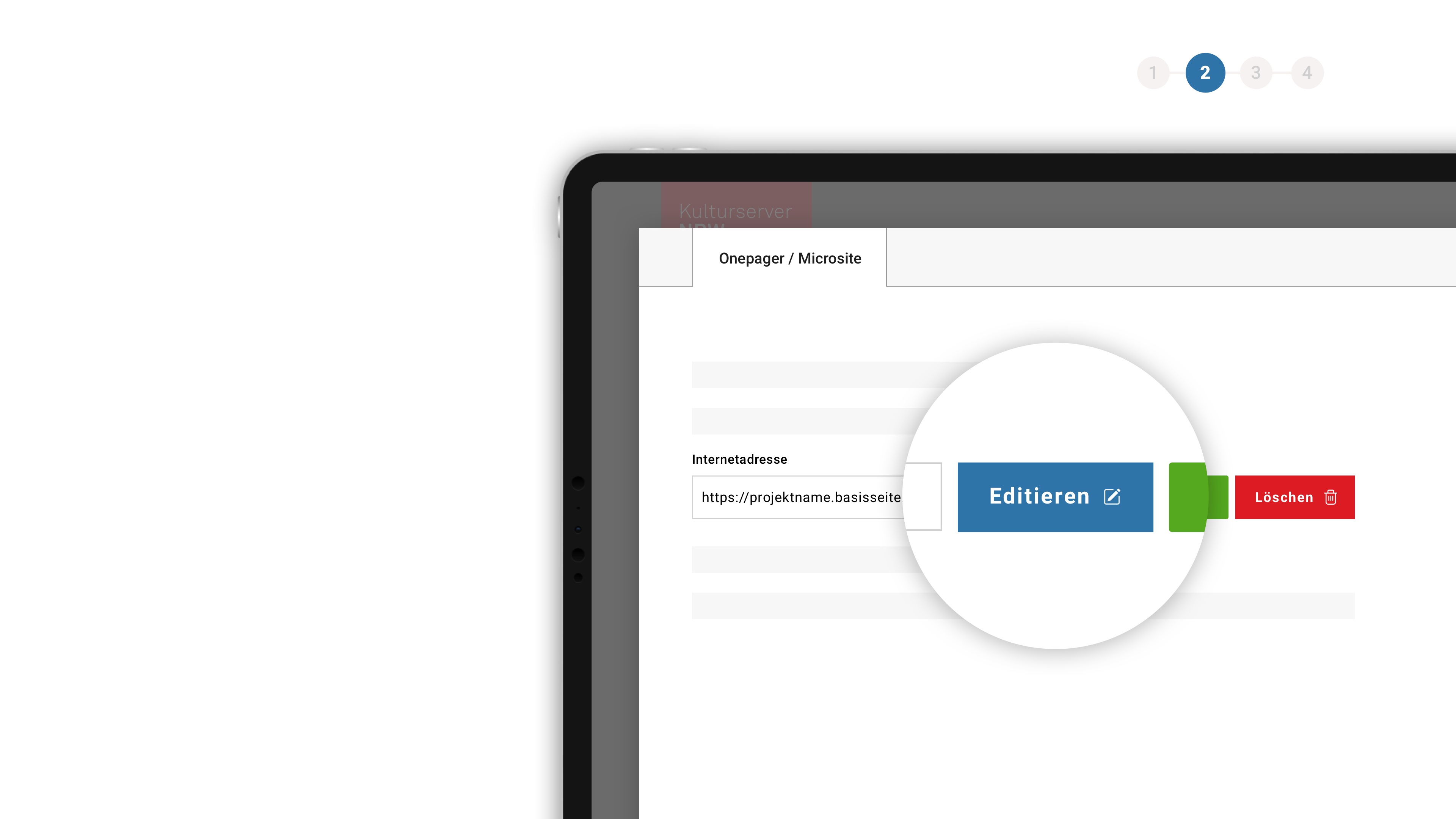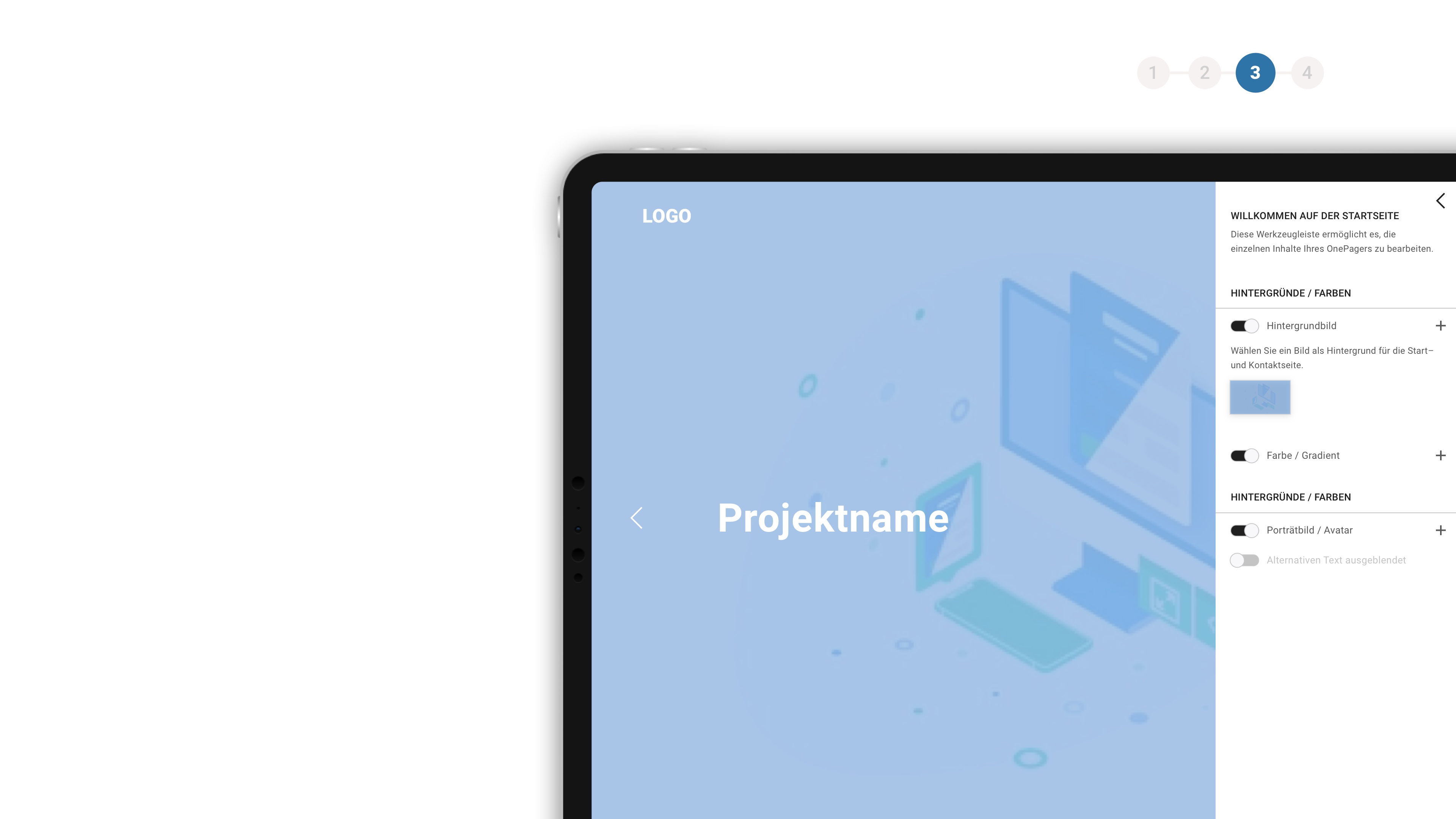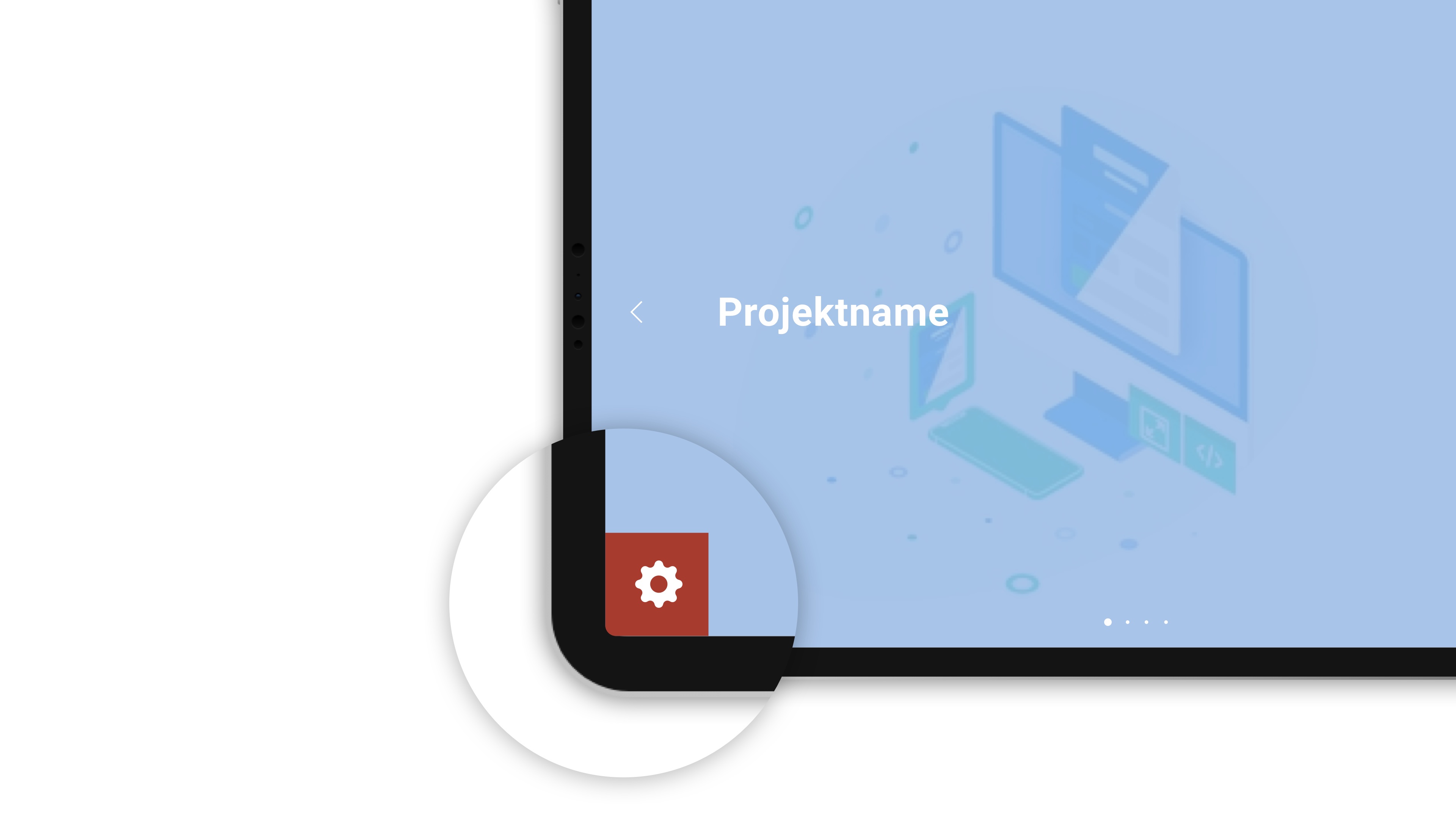Ein Ehe-Selfie, gepostet 1924: „Intermezzo“ von Richard Strauss oder Oper als Beziehungsspiegel - Deutsche Oper Berlin
Aus dem Programmheft
Ein Ehe-Selfie, gepostet 1924: „Intermezzo“ von Richard Strauss oder Oper als Beziehungsspiegel
Ein Essay von Richard Erkens
„Man muss doch noch das Recht haben, Privatperson bleiben zu dürfen“: Diesen Anspruch legte Richard Strauss, der erstmals wieder seit dem GUNTRAM und erstmalig für eine „bürgerliche Komödie“ zum eigenen Textdichter wurde, der Bühnenfigur Christine in den Mund. Sie ist die Gattin des berühmten Hofkapellmeisters Robert Storch, der kurz zuvor in routinierter Geschäftigkeit das Haus am Grundlsee im steirischen Salzkammergut verlassen hatte, um für die nächsten zwei Monate seinen Dirigierverpflichtungen in Wien nachzukommen. Seine „bessere Hälfte“, wie – zum Missfallen Christines – ein Kritiker sie einmal bezeichnete, bleibt mit dem achtjährigen Sohn im privaten Reich eines großbürgerlichen Haushaltes zurück, dem sie ambitioniert wie energisch vorsteht. Kammerjungfer, Stubenmädchen und Köchin wollen beaufsichtigt sein. Dass die Handlung der neuen Strauss-Oper ein familiäres Selbstporträt, genauer: die autobiographisch beglaubigte Episode seiner inzwischen 30-jährigen Ehe mit der Sängerin Pauline Strauss-de Ahna ist, wussten bei der Dresdner Uraufführung im Jahr 1924 unter der Leitung des noch jungen Fritz Busch nicht nur enge Vertraute. Auf Verschlüsselung des biographischen Selbstbezuges war dieses Werk niemals angelegt.
Im Gegenteil: das musiktheatrale Ehe-Selfie ante litteram war mit voller Absicht des Dichterkomponisten keine Oper der versteckten Anspielungen oder verklausulierten Subtexte. Die Veroperung der eigenen Ehe sollte offenkundig sein. Maskierung und Camouflage waren Strauss im Leben wie im Werk eigentlich wesensfremd. Die Krise, in welche diese Beziehung kurzzeitig stürzt(e), basiert(e) im Realen wie im Fiktiven auf komödientypischer Verwechslung und gestörter Kommunikation. Sie steigert sich bis zu handfesten Scheidungsabsichten, als endlich der Zufall die Irritationen auflöst und das Paar sich wiederbegegnen kann im gegenseitigen Vertrauen, das zwischen ihnen einmal existierte. Also: ein Intermezzo mit gewissem Erinnerungswert, im Rückblick eine komische Episode, aber nichts im Vergleich zu den Jahrzehnten engster Verbundenheit einer – was sie faktisch war – 55-jährigen Lebenspartnerschaft. Das Schlusswort formuliert die Bühnen-Pauline als rhetorische Frage: „Gelt, mein lieber Robert, das nennt man doch wahrhaftig eine glückliche Ehe?“ Das ist mindestens so vielschichtig gedacht und auf eine komplexe Beziehungsrealität bezogen wie das durch den Librettisten Strauss thematisierte, aber zugleich durch ihn verletzte Recht seiner Frau, „Privatperson bleiben zu dürfen“. Das Einverständnis zur Veröffentlichung der Bildrechte Paulines am geposteten Ehe-Selfie von 1924 hat der Komponist höchstwahrscheinlich nicht vorab eingeholt.
Karl Holl, Uraufführungsrezensent der „Frankfurter Zeitung“ und Vertreter der jüngeren Generation, erklärte diese nicht allein opernhistorisch exzeptionelle „Selbstpreisgabe“ von Strauss interessanterweise mit dessen repräsentativer Zugehörigkeit zur wilhelminischen Epoche. Die Zeit der „übersteigerten Persönlichkeitsgeste, der manischen Projektion nach außen“, so Holl, sei indes vorbei. Eine derartige Aussage verwundert angesichts der vielfältig die Lebensrealitäten beeinflussenden Modernismen, die sich in den krisengeschüttelten Nachkriegsjahren der Weimarer Republik Bahn brachen: Emanzipationen von Rollenbildern und sozialen Hierarchien, neupulsierende Körper-, Lebens- und Arbeitsrhythmen – die anbrechenden Goldenen Zeiten eines neuen Modernitätsverständnisses waren keineswegs weniger individualitätsbetonend und extrovertiert. Dennoch klingt hier eine Skepsis an. Dem inzwischen 60-jährigen Strauss wollte man nicht recht zubilligen, sich selbst so sachlich-ungeschminkt in Szene zu setzen. Und das zudem mit der öffentlich durch seine Ehe zur Schau gestellten wie subtil beglaubigten Tauglichkeit eines konservativen Beziehungsmodells, welches durch die sozialen Wandlungen nicht mehr kritiklos Bestand hatte. Wie passte dieses tendenziell antiquierte Beziehungsporträt zusammen mit dem Skandalkomponisten von einst, dessen SALOME von 1905 die gesamte Musikwelt samt den Sittenwächtern nicht allein der preußischen Zensurbehörden auf den Plan rief und den bereits arrivierten Dirigenten und Instrumentalkomponisten Strauss mit einem Schlage an die Speerspitze der Opernavantgarde katapultierte? Nun im Jahr 1924 überraschte er wieder, aber mit einer bis dato auf dem Musiktheater unbekannten wie zugleich betulichen homestory-Ästhetik der Vorkriegsjahre, die bei der Dresdner Erstproduktion selbst die visuelle Dimension erfasste. Das Bühnenbild orientierte sich stilistisch am Interieur der Strauss-Villa in Garmisch, und Bariton Josef Correck in der Rolle des Robert trug eine gelockte Perücke mit Geheimratsecken, um dem im Publikum sitzenden Richard möglichst ähnlich zu sehen.
Der Gesamtkontext der Uraufführung tat ein Übriges, um Innerliches forciert nach außen zu kehren: Die erste Opernpremiere, die Strauss im turbulenten Klima der jungen Weimarer Republik realisierte, bedeutete ebenso eine Rückkehr an das Uraufführungshaus seiner Erfolge von SALOME, ELEKTRA und ROSENKAVALIER. Dem menschlich wohlwollenden wie künstlerisch erstklassigen Ambiente der Sächsischen Hof- bzw. jetzt Staatsoper konnte er sich sicher sein. Zugleich war diese Produktion programmatischer Abschluss der Feierlichkeiten zu seinem 60. Geburtstag – man warb mit Richard-Strauss-Tagen an der Semperoper und lud dann zur Weltpremiere ins ‚kleinere‘ Schauspielhaus, der ‚intimen‘ Faktur des neuen Werkes Rechnung tragend. Es konnte nicht ausbleiben, dass Lotte Lehmann, auf Wunsch des Komponisten die Christine/Pauline interpretierend, nach der Premiere im Beisein des Ehepaares von einem „wunderbaren Geschenk“ sprach, das Strauss mit dem INTERMEZZO seiner Frau gemacht habe. Paulines harsche Antwort – „Wurscht!“, so die Überlieferung – und was sie empfunden haben mochte bei der Konfrontation coram publico mit ihrem Bühnen-Ich, markiert die Grenzlinie zwischen der Schutzsphäre eigener Empfindungen und einer ans Licht der Öffentlichkeit gezerrten Intimität, der das Recht auf Privatheit entzogen wurde. Der „berühmte Mann“ machte sich in erster Linie selbst ein Geschenk und nicht Pauline, die, gut anderthalb Jahre älter als er und als ehemalige Sängerin mit internationaler Laufbahn ebenso wenig publikumsscheu, genau kein öffentlichkeitswirksames Wiegenfest in Dresden feierte.
Vorgeschichte(n)
Vermutete (eheliche) Untreue und Eifersucht zum Thema einer Oper mit Intrigenhandlung zu machen, gehörte spätestens seit der steilen Erfolgskurve komischer Operngenres ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Grundausstattung eines musikdramaturgischen Werkzeugkastens. Der vielbelesene und geschichtlich beeindruckend sattelfeste Strauss nimmt nicht zuletzt mit dem Titel INTERMEZZO darauf Bezug. Ebenso klingt im Shakespeare-Zitat „Hast du schon zur Nacht gebetet, Desdemona!“, mit dem der Kammersänger während der Skatszene am Beginn des zweiten Aufzugs seine Siegesgewissheit „dröhnend“ verkündet, auch die tödlich-tragische Dimension von Eifersucht an, die dem Opernpublikum seit 1887 durch Giuseppe Verdis OTELLO bestens bekannt war. Doch auch der Typus der ehelichen Beziehungskomödie hielt während der langen Jahrhundertwende mit den Zeitthemen Schritt und aktualisierte diese fortwährend im Sinne eines realistisch-gegenwärtigen Theaters und im Erbe früher neapolitanischer Dialektkomödien, welche – heute oft vergessen – die ersten abendfüllenden Musikkomödien waren. Gleichfalls kaum mehr präsent ist das „Intermezzo“ von Ermanno Wolf-Ferrari, SUSANNENS GEHEIMNIS, das seit der Uraufführung 1909 am Münchner Hoftheater ein Dauerbrenner auf deutschsprachigen Bühnen bis hinein in die 1950er Jahre war. Der Verdacht des Gatten auf die Untreue seiner deutlich jüngeren Frau nährt sich hier durch einen fremden Geruch im Haus; seine vorgetäuschte Abreise mit überraschender Rückkehr soll den Liebhaber stellen und Susannens erotisches Geheimnis lüften – indes: sie raucht nur, und das aus Langeweile in der Partnerschaft. Im Vergleich zu derartig traditionellen Intrigendramaturgien wird deutlich, was Strauss anders machte, denn sein INTERMEZZO ist intrigenfrei. Keine der Personen verstellt sich oder spielt – wie noch im ROSENKAVALIER von 1911 – gezwungenermaßen oder freiwillig eine (Verkleidungs-)Komödie, um eine vermeintliche moralische Verfehlung, einen triebhaft übergriffigen Schwerenöter – kurz: eine bewusst verborgen geglaubte Wahrheit ans Licht zu bringen und um die erlittenen Kränkungen in eine Anklage an den ‚schuldigen Partner‘ verwandeln zu können oder – wiederum am Puls der Zeit – den Weg der Trennung einzuschlagen.
Bei Strauss entstehen die emotionalen, glücksbedrohenden Turbulenzen der Figuren im INTERMEZZO aus zufälliger Verwechslung und affektiver Überreaktion. Der Untreueverdacht führt nicht in den konventionellen, dramaturgischen Ereignisrhythmus einer fein abgestuften Intrige mit gut platzierter Schlusspointe, sondern zur Verweigerung von Kommunikation: Christine/Pauline liest die erklärenden Telegramme von Robert/Richard aus Wien nicht mehr, glaubt den Betrug erwiesen und sieht als Ausweg nur die Flucht aus dem gemeinsamen Leben. Erschütterung und Angst sind die Folgen. Die Überwindung der gegenseitigen Isolation erfolgt dann en passant, während sich das eigentliche emotionale Drama hauptsächlich in den sinfonischen Zwischenspielen vollzieht. Hugo von Hofmannsthal, dem Strauss die Pläne zu solch einer „ganz moderne[n], absolut realistische[n] Charakter- und Nervenkomödie“ 1916 mit Eifer unterbreitete, lehnte seine Mitarbeit ab. Die märchenhaft-symbolbeladene FRAU OHNE SCHATTEN, an der das kongeniale Künstler-Gespann noch feilte, war, so Jürgen Schläder, weiterhin der „retrospektiven Dramenästhetik“ des Dichters verpflichtet. In einem prosaischen Alltags-Intermezzo erkannte dieser keine Handlung mit dramatischen Effekten, sondern lediglich ein „Charaktergemälde“, das, so Hofmannsthal in einem späteren Brief von 1928, uns „nicht ins Geschehen“ hineinreißen könne.
Für Strauss bildete das offensichtlich kein starkes Argument, denn er selbst war das „Geschehen“: die Episode ist seine Lebensrealität und die modellierten Figuren ein Charakterspiegel seiner Beziehung zu Pauline. Strauss’ „vielleicht allzu kühne[r] Griff ‚ins volle Menschenleben‘“, wie er – Goethes Lustige Person aus dem „Faust“ im Vorwort zu INTERMEZZO zitierend – konzediert, ist seine persönliche Erinnerung an den Mai 1902. Damals war er Hofkapellmeister der Berliner Hofoper Unter den Linden und befand sich auf Konzertreise in England. Pauline, mit dem fünfjährigen Sohn in der Berliner Wohnung zurückbleibend, las einen fälschlicherweise an ihren Mann adressierten Brief, abgeschickt von einer „Mieze Mücke“. Diese würde am nächsten Tag wie gewohnt in der Union-Bar auf ihn warten. Pauline sah rot und den Ehebruch bewiesen, verweigerte für drei Tage die Kommunikation und bereitete rigoros wie blindwütig die Scheidung vor, u. a. indem sie eine nicht unerhebliche Geldsumme von der Bank abhob – ein Fluchtimpuls. Doch lediglich eine Namensverwechslung lag vor: Kapellmeister Josef Stransky sollte der Adressat sein, „Mieze Mücke“ hatte falsch memoriert. In INTERMEZZO wird aus ihr „Mieze Maier“, die eigentlich an den Kapellmeister Stroh schreiben wollte. Wenn die Bühnen-Christine von ihren „Leiden“ und „Seelenqualen“ spricht und Robert ihr schließlich gesteht, es sei „die schlimmste Zeit meines ganzen Lebens“ gewesen, dann drängt sich im Wissen um die jahrzehntelange Lebenspartnerschaft von Pauline und Richard die Überzeugung auf, dass sich unter dieser sprachlichen Oberfläche eine Gefühlstiefe verbirgt und eine Wahrhaftigkeit des Ausdrucks zum Vorschein kommt, welche die Schwere beglaubigt, die hinter den meisten Komödien liegt. In INTERMEZZO gelangen die Ehepaare kurzzeitig an ihre existenziellen Grenzen, sie fallen vollständig aus der Bahn: die Sturmszene im Wiener Prater ist dafür gleichsam romantisch-beredtes Natursymbol. So wollte es Strauss: aus „harmlos[en] und unbedeutend[en]“ Anlässen einer „von vorneherein bagatellisiert[en]“ Handlung sollen „die schwersten Seelenkonflikte, die in einem Menschenherzen sich bewegen können“, hervorgerufen werden.
Derartig heftige Reaktionen Paulines besitzen auch ihre Vorgeschichten. Liest man die Briefe der Eheleute und jungen Eltern aus den Jahren davor, wird verständlich, dass ein deftiger, offener und nicht selten verletzender Tonfall zwischen ihnen keine Seltenheit war. Dass sich die damals noch aktive und international erfolgreiche Sängerin nach außen hin gegenüber dem Erfolg ihres Mannes zurückgesetzt sah, ihn auch gar nicht mehr richtig liebe und an Trennung denke, war eine Konstante, die sich in die Dialoge von INTERMEZZO gleichsam von selbst hineinschrieb: „Du hast mich nie gewürdigt, nie verstanden, immer vernachlässigt“, klagt Christine noch im finalen Dialog. Eine zweite Konstante aber bildete dazu ein Gegengewicht, nämlich die der wortlosen Zuneigung, der alltäglichen Fürsorge und des inneren starken Bandes, das die beiden zusammenhielt und das mit den Trennungsambitionen während der „Mieze Mücke“-Affäre, die ja gar keine war, seinen Lackmustest bestand. Mit impulsivem Kräftemessen und heftigen Ausbrüchen begann der biographischen Überlieferung nach schon diese Beziehung, als Pauline, 1894 im GUNTRAM die Freihild singend, während der Probenarbeit den Klavierauszug nach Richard schleuderte. Zur großen Überraschung der Musiker der Weimarer Hofkapelle entließ der Komponist die schier unkontrollierbare Sängerin nicht. Stattdessen verkündete er – nach einer ‚Aussprache‘ unter vier Augen – seine Verlobung mit dem „Fräulein de Ahna“. Eine öffentliche Dimension, welche auf die Eigenarten der Beziehung schließen ließ, besaß diese Ehe schon seit ihrem Beginn. Hat der Beziehungsspiegel von 1924 also überhaupt viel Neues preisgegeben und Privatrechte verletzt?
Ehe-Exhibitionismus, werkübergreifend
Nach außen hervorstechend waren auch die Charaktereigenschaften Paulines. Sie sind nicht nur legendär, sondern auch ein Schlüssel zum Verständnis vieler Werke des Komponisten. Zahlreich sind die Kommentare von Zeitzeugen. Graf Harry Kessler, um nur einen zu nennen, vertraute seinem Tagebuch die „vernichtende Taktlosigkeit“ und „halbhysterischen Unartigkeits-Anfälle“ Paulines an, die sie zu einem veritablen Risikofaktor auf dem gesellschaftlichen Parkett machte. In ihrem Mann fand Pauline ihren größten Fürsprecher. Auch diese Dimension ist in INTERMEZZO gespiegelt, unterhält sich doch die skatspielende Männerrunde (auch das ein Fixpunkt des biographischen Anekdoten-Repertoires über den Komponisten) über die exponierten Eigenschaften der „besseren Hälfte“: ein „Ekel“ sei sie, die einen „ins Irrenhause“ brächte, ätzt der Commerzienrat. Ohne Entrüstung verteidigt der Bühnen-Richard gelassen diese nicht minder taktlosen Äußerungen: was er sei, verdanke er ihr, der „zarten schamhaften Natur[…] mit rauher Schale“. Erst als ihr Scheidungs-Telegramm erhält, verliert er den inneren Halt und nach außen hin die Fassung.
Die Spuren Paulines in der Musik von Richard sind unübersehbar: explizit in den ihr gewidmeten Liedern, darunter das Hochzeitsgeschenk der „Vier Lieder“ op. 27 von 1894, oder hintergründig durchscheinend im leitmotivischen Gebilde der Gefährtin in der Tondichtung „Ein Heldenleben“ 1898 oder in der komplexen Charakterstudie der Färberin in der FRAU OHNE SCHATTEN. Mit der „Sinfonia domestica“, die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur realen „Mieze Mücke“-Episode konzipiert und dann 1904 in New York uraufgeführt wurde, legte Strauss eine große Tondichtung vor, die einen Tag seines Familienlebens mit Frau und Kind musikalisch porträtierte. Er fände sich „ebenso interessant wie Napoleon und Alexander“, entgegnete der Komponist Romain Rolland, der die Alltäglichkeit und Selbstbezogenheit des Sujets kritisierte – ein kontinuierlicher Trivialitätsvorwurf, den Udo Bermbach ebenso für INTERMEZZO im Jahr 2000 aktivierte, als er Strauss vorhielt, in den Krisenzeiten nach dem Ersten Weltkrieg nichts weiter als die „Banalprobleme einer Künstlerehe auf die Opernbühne“ zu bringen. In beiden thematisch eng verwandten Werken überdeckte stets das situative Ehe-Selfie – also die imaginierte wie theaterreale Bildlichkeit einer großbürgerlich-ländlichen Familienszenerie der Vorkriegsgesellschaft – die ästhetischen Innovationen von Werkkonzeption und Orchestersatz. Aber auch die Radikalität der programmatischen Sinnschicht in der „Sinfonia domestica“, nimmt man sie denn ernst, wurde kaum beim Namen genannt. Sie steigert sich im Adagio-Teil, eine eheliche Liebesnacht darstellend, nachdem Sohn „Bubi“ ins Bett gebracht wurde, zu dem Nachvollzug eines partnerschaftlich erlebten Orgasmus durch motivische, gestische und harmonische Mittel – eine pornographische Dimension im Medium der Instrumentalmusik, die in diesem Kontext nichts weniger als einen Exhibitionismus auch des erotisch-sexuellen Ehelebens von Strauss darstellt.
In INTERMEZZO ist diese sinnliche Ebene größtenteils ausgeklammert. Das zwanzig Jahre nach der „Sinfonia domestica“ uraufgeführte „realistische […] Spielöperchen“, wie Strauss es während der Kompositionsphase einmal nannte, spiegelt eine Alltagswirklichkeit, der die körperliche Leidenschaft der jungen Jahre abhandengekommen scheint. Die Erotik in INTERMEZZO ist – und das ist kein geringer Befund in der werkübergreifenden Perspektive – ins Bedrohlich-Außereheliche verlegt. Dies wird überdeutlich durch die „Sympathie“, die Christine dem Baron Lummer entgegenbringt, nachdem sie mit ihm zufällig auf der Rodelbahn ‚zusammengestoßen‘ war. „Endlich einmal ein junger frischer Mensch“, singt sie walzerbeschwingt (auf einer motivischen Reminiszenz an den gemeinsamen Tanz beim Grundlseewirt), nachdem sie dem fernen Ehemann brieflich von der Bekanntschaft berichtet hat. Lummer registriert diese Gefühlsschwingungen und versucht, daraus Kapital zu schlagen; dass sich Christine damit potentiell befähigt zeigt, auch einmal von den eingefahrenen erotischen Ehegleise abzubiegen, wird am Ende für Robert/Richard zu einem nicht unwillkommenen Argument, seinerseits ihrem heftigen wie grundlosen Untreue-Vorwurf zu parieren. Und während der Skatszene lässt es sich der reale Komponist Richard nicht nehmen, eine ‚Anspielung‘ auf die ‚Anspielung‘ in die Musik hineinzuschreiben: Wenn Storch von der „netten Gesellschaft“ seiner Frau berichtet, erklingt ein repetiertes Hornsignal, die ‚Jagd‘ und den ‚Gehörnten‘ gleichermaßen kommentierend.
Mit Blick auf derart feine Differenzierungsgrade des ehelichen Beziehungsspiegels wird ein Stück weit verständlich, warum Strauss dank seiner Ehe mit Pauline eine schier unerschöpfliche Inspirationsquelle für seine musikalische und theatrale Kunst besaß. Auch dachte er im Zuge der Erneuerung von Konversationsopern, die er mit INTERMEZZO angestoßen hatte, an einen ganzen Komödien-Zyklus über „die Frau von verschiedenen Seiten gesehen“. Doch wer hätte diesen Weg als Librettist mit ihm gehen sollen? Hofmannsthal stand dafür nicht zur Verfügung, und seine Vermittlung an Hermann Bahr, der auch im modernen Lustspiel-Genre erfolgreich war, blieb letztlich erfolglos. Zwar erarbeitete der österreichische Dramatiker 1917 nach den Vorgaben von Strauss ein Szenarium, doch war er weitsichtig genug zu erkennen, dass jede fremde Feder das geplante Ehe-Selfie in seiner Authentizität und ungefilterten Selbststilisierung verfälscht hätte. Ermutigt durch Bahr, machte sich Strauss schließlich selbst ans Werk. Die Skizze wurde im Februar 1919 – also noch vor der Uraufführung von FRAU OHNE SCHATTEN im Oktober desselben Jahres – fertiggestellt, doch zog sich die Ausarbeitung der Orchesterpartitur bis zum August 1923 hin. Nicht am häuslichen Esstisch in Garmisch, sondern während seiner zweiten Südamerika-Tournee mit den Wiener Philharmonikern in Buenos Aires setzte Strauss die letzte Note von INTERMEZZO aufs Papier.
Vorwort und „Dialogfarbenskala“ für stilistische Innovation
Strauss sah sich veranlasst, und das ist bemerkenswert wie singulär in seinem Schaffen, der Partitur ein Vorwort beizufügen, das sich mehr an die Ausführenden als an das Publikum richtet. Es berührt das grundsätzliche Problem Nach-Wagner’schen Opernkomponierens, nämlich die ständig gefährdete Balance zwischen Orchester und Singstimmen. Orchestergröße und Orchesterpolyphonie tendieren – und hier hatte Strauss nicht erst mit der „überinstrumentierten“ SALOME mehr mit sich selbst als mit dem Vorbild Wagner zu kämpfen – zu einer instrumentalen Klangbarriere, welche die Gesangsstimmen kaum mehr textverständlich überwinden können. Der räsonierende Komponist verweist besonders auf seine ARIADNE AUF NAXOS, deren ‚reduzierter‘ Orchesterapparat bereits 1912 einen innovativen Weg vorzeichnete, Textverständlichkeit und vokale Nuancierung der Gesangssolisten mit der gewohnten luxurierenden Klangästhetik des Orchesters zu verbinden. Indes: die „Kammerorchester“ von ARIADNE wie auch von INTERMEZZO orientieren sich zwar wieder an einer zweifachen Bläserbesetzung, sind aber immer noch größer aufgestellt als jede Standardoper aus der Zeit der Wiener Klassik. Daher geht sein Apell an die Dirigenten, keine das Blech anfeuernden „Pultvirtuosen“ zu sein, an die Instrumentalisten, die in der Partitur feinabgestufte Orchesterdynamik auch gegen den eigenen Höreindruck streng zu beherzigen und an die Sängerinnen und Sänger, mit der „Stoßwaffe“ eines „regelrecht gebildete[n] Konsonanten“ sich gegen die „Tonfluten“ zu rüsten. Kurz gesagt: „mit halber Stimme singen und deutlich aussprechen“, anstatt mit forcierter Stentorstimme triumphierend aus dem ästhetischen Gesamtrahmen fallen zu wollen. In INTERMEZZO, so der schalkhafte Strauss, gäbe es ohnehin keine „Arienappläuse“ zu holen, und „die arme Claque“ bliebe bei Aufführungen dieses Werkes verdienstlos und hungrig.
Weiterentwickelt hat Strauss – auch das betont er im Vorwort – den kompositorischen Umgang mit der dialogischen Spielhandlung, begründet aus thematischer Notwendigkeit. Der „ganz aus dem realen Leben geschöpfte, von nüchternster Alltagsprosa“ durchwebte Stoff, der nur an wenigen Stellen „gefühlvollen Gesang“ erlaube, musste zwangsläufig die Palette an deklamatorischen Formen auffächern, damit der Dialog durchgängig verständlich bliebe, dem Strauss gegenüber seinen anderen Werken die „größte“ Bedeutung beimisst. Es wäre verfehlt, dies als Herabsetzung seiner bisherigen Librettisten – allem voran von Hofmannsthal – zu lesen. Genau weil es im dargestellten Alltagsgeschehen kaum „sogenannte Cantilenen“ zu entwickeln gäbe, müsse der künstlerisch gestaltete Dialog die höchste Priorität an Aufmerksamkeit erhalten. Gleichsam kompensatorisch dazu verlegte Strauss – auch das benennt er selbst – „die Darstellung der seelischen Erlebnisse“ in die sinfonischen Zwischenspiele. Die stilistische Innovation ist demnach das, was er als „Dialogfarbskalen“ bezeichnet – eine Ausdifferenzierung aller Möglichkeiten der Verbindung von Singen und Sprechen, die vom gesprochenen Dialog, über das Melodram, das Secco- und Accompagnato-Rezitativ bis hin zur ariosen Deklamation führt. Es sei ein „dem Alltagsleben abgelauschter und nachgebildeter Gesprächston“ – vielleicht noch genauer: die persönliche Prosodie der bürgerlichen Privatheit von Pauline und Richard. Inwieweit die Partitur diesen Anspruch einlöst, zeigt beispielhaft gleich der Beginn. Christines Rufe nach der Kammerjungfer: „Anna! Anna!“ – eine kurze Floskel fallender Septimen, instrumental unbegleitet – werden reflexhaft vom Orchester wiederholt und klanglich intensiviert. Geteilte Streicher mit spitzer Oboenterz im Fortissimo (ein weiterhin zunächst aufgesparter dynamischer Akzent) bilden eine von vielen mosaikhaften Farben der Dialogskala, die hier der Charakterisierung Christines dienen. Als subtiles Echo erscheint sie modifiziert in der Skatszene, wenn Robert fassungslos die Scheidungsnachricht liest und der Commerzienrat boshaft fragt, ob der „Igel“ wieder steche.
Die Verzahnung von Singstimme und motivisch-polyphonem Orchestergewebe, das sich tatsächlich in Dynamik und Stimmverflechtung gegenüber dem vokalen Dialog ständig zurücknimmt, ist die technisch-progressive Faktur von INTERMEZZO. Und in ihr ist auch das eingelassen, was die Strauss’sche Charakterisierungskunst durch Musik ohnehin immer konnte und auch weiterhin kann – zugeschnitten aber auf den neuen Realismus, der indes „im Ton des fin de siècle“ und nicht als Neue Sachlichkeit erscheint, wie Ulrich Konrad bemerkt. Erwähnt seien bespielhaft die Glissandi der Rodelbahn, die persiflierende Quarten-Harmonik, in welcher Baron Lummer in der sechsten Szene des ersten Aufzugs seinen Schlager trällert („Theresulein, Theresulein“) oder die Akkord-Motorik aus Streichern und Klavier, mit der das Kartenmischen am Beginn der Skatszene auch zum musikalischen Ereignis wird. In diesem Kabinettstück mischt Strauss nicht weniger virtuos die Karten musikalischer Zitate: der Beginn von Mozarts FIGARO-Ouvertüre ist bei Eintritt von Robert Storch als Verweis auf seine gerade beendete Orchesterprobe zu hören, ebenso wie ein überdeutlich platzierter Tristan-Akkord als Illustration der durch die damenlose (!) Skatpartie ermöglichte „Erholung nach Musik“. Die Anspielung an die Wagner’sche „Metaphysik der Kunst wie der Liebe“ sei dadurch „gesellschaftlich relativiert“ im sozialen Wandel der Nachkriegsjahre, so etwa Hermann Danuser. Diese Beispiele mögen genügen, um die Interpretationstiefe und den Detailreichtum der musikdramatischen Beredsamkeit anzudeuten, die der Komponist noch ‚unter‘ die Oberfläche der vokalen „Dialogfarbenskala“ legte.
Ein Intermezzo auf dem Weg zur Zeitoper?
Ob Strauss nicht mit „seiner Opera domestica INTERMEZZO” die Zeitoper der zwanziger Jahre eingeläutet habe, konnte Ulrich Schreiber noch im Jahr 2000 fragen. Diese Vorsicht erstaunt mit Blick auf den experimentellen Selbstentäußerungs-Charakter dieser Oper samt ihren ästhetischen Innovationen, zu der nicht zuletzt auch eine visuelle Schnitttechnik gehört, mit welcher der „Dramaturg Strauss“ die insgesamt 13 Szenen quasi als Abfolge schnell und mitunter unerwartet wechselnder Kinobilder konzipierte. Mit dem Gedanken, dass Strauss – unzweifelhaft ein Protagonist der musikalischen Moderne vor dem Ersten Weltkrieg, aber für die Zeitgenossen auch schon, um mit Stefan Zweig zu sprechen, ein Mann aus der Welt von Gestern – noch zu den opernhistorischen Impulsgebern der 1920er Jahre zu zählen sei, tut sich mancher noch schwer. Ganz gewiss führt über INTERMEZZO der Weg im Allgemeinen zur sogenannten Zeitoper und im Besonderen zu NEUES VOM TAGE von Paul Hindemith und zu VON HEUTE AUF MORGEN von Arnold Schönberg. Doch marginalisiert diese historiographische Linienführung ein Stück weit den Charakter sui generis des Ehe-Selfies von 1924. INTERMEZZO ist viel mehr als bloß ein Zwischenstopp. Das „zwiespältige künstlerische Denkmal“, das – um noch einmal Danuser zu zitieren – Strauss seiner Frau setzte, mag besonders mit der heutigen Sensibilität für Persönlichkeitsrechte befremden. Doch die ehebespiegelnde „Selbstpreisgabe“ wie die „Abkehr von den altbewährten Liebes- und Mordaffären“ (so das Vorwort), die diesem Werk eingeschrieben sind, machen es zu einem Solitär, dessen tatsächliche Nachfolger radikal-autobiographischen Musiktheaters, welche über dasselbe Gestaltungsvermögen an darstellerischer Vielschichtigkeit und Komplexität verfügen, bis heute schwer auszumachen sind.
Wenige Monate vor seinem Tod im September 1949 trieb Strauss noch die Frage um, warum „das Neue“ an seinen Werken nicht erkannt würde. Gerade das „Bekenntnis in INTERMEZZO“ sei beispielhaft, wie in seinem dramatischen Werk „der Mensch sichtbar in das Werk spielt“ im Unterschied zu anderen Opern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die kompromisslose Darstellung der eigenen Individualität – gespiegelt in seiner Beziehung zu Pauline – erfordert tatsächlich eine Korrektur der Verortung von INTERMEZZO nicht nur im Gesamtwerk von Strauss. Schönberg erkannte das: „Ich bin nicht ein Freund von Richard Strauss, aber, obwohl ich nicht alle seine Werke bewundere, glaube ich, daß er eine der charakteristischen und hervorragenden Figuren in der Musikgeschichte bleiben wird. Werke wie SALOME, ELEKTRA, INTERMEZZO und andere werden nicht vergehen.“ Hundert Jahre nach der Dresdner Uraufführung und im Wissen um heutige Dimensionen digitaler, den Alltag zum Ereignis machender Selbstentäußerungen können der Aktualitätsbezug und – vieldeutig wie die Kunst von Strauss ohnehin – auch die Zeitentbundenheit von INTERMEZZO neu bestimmt werden.