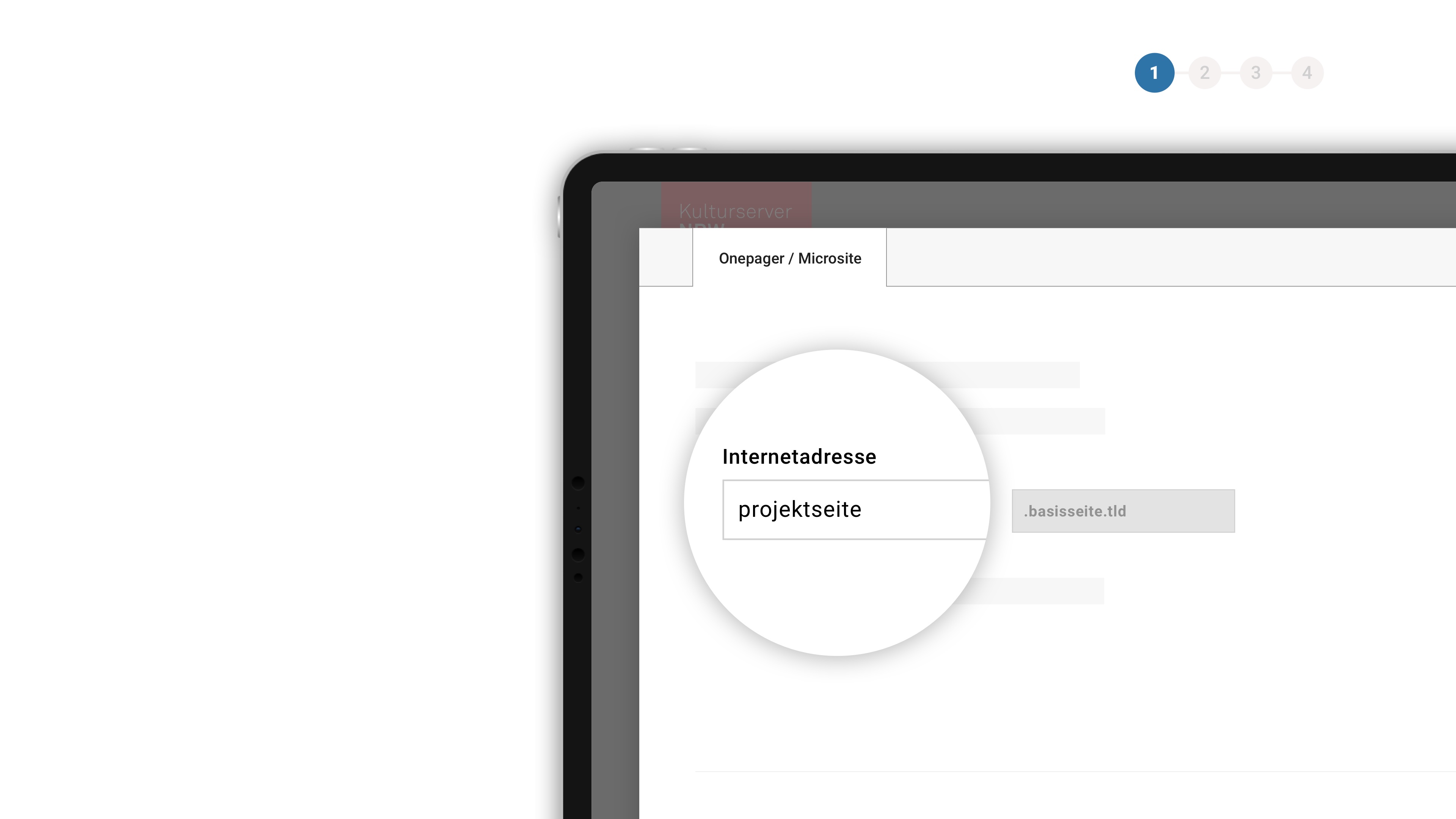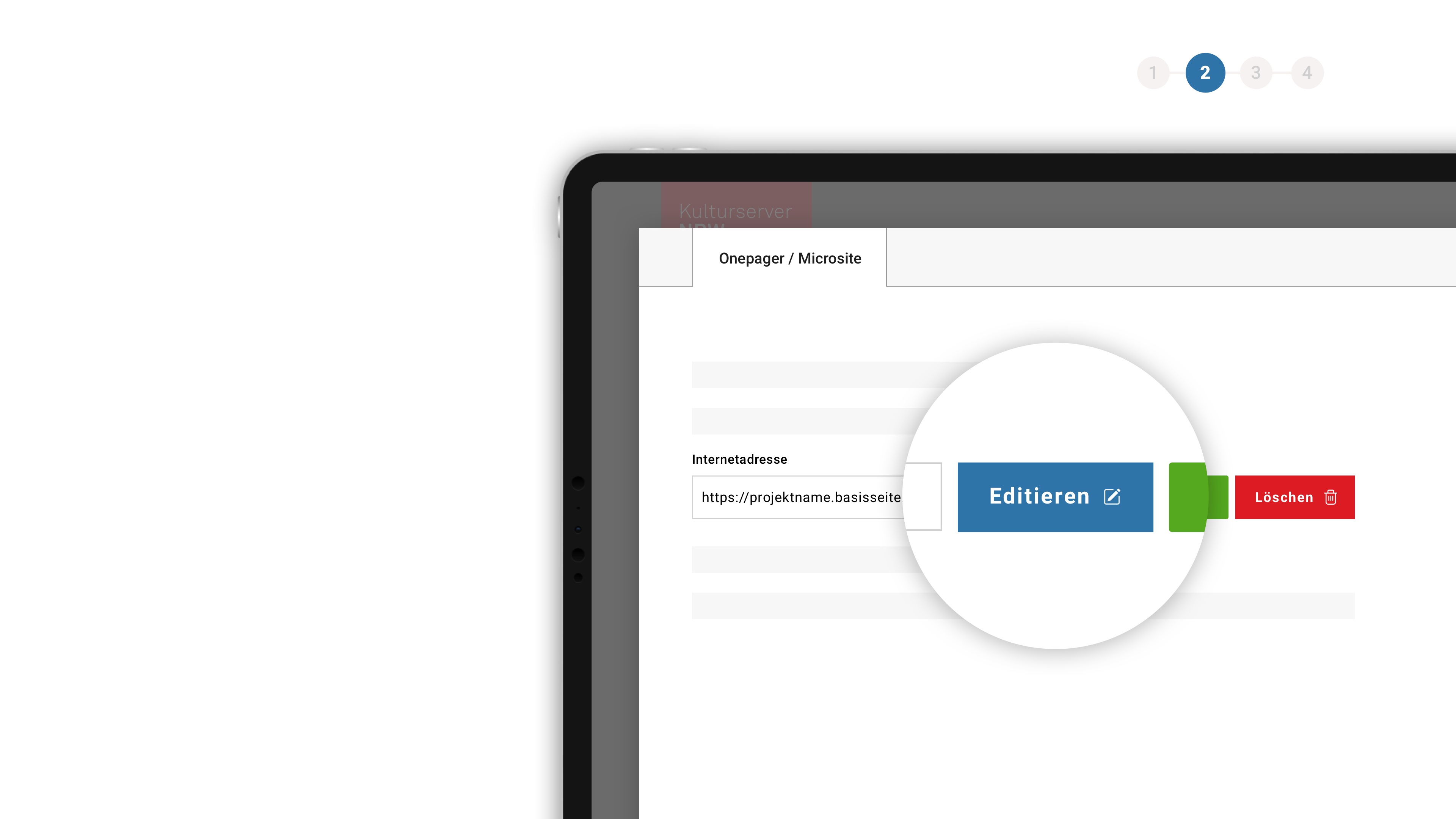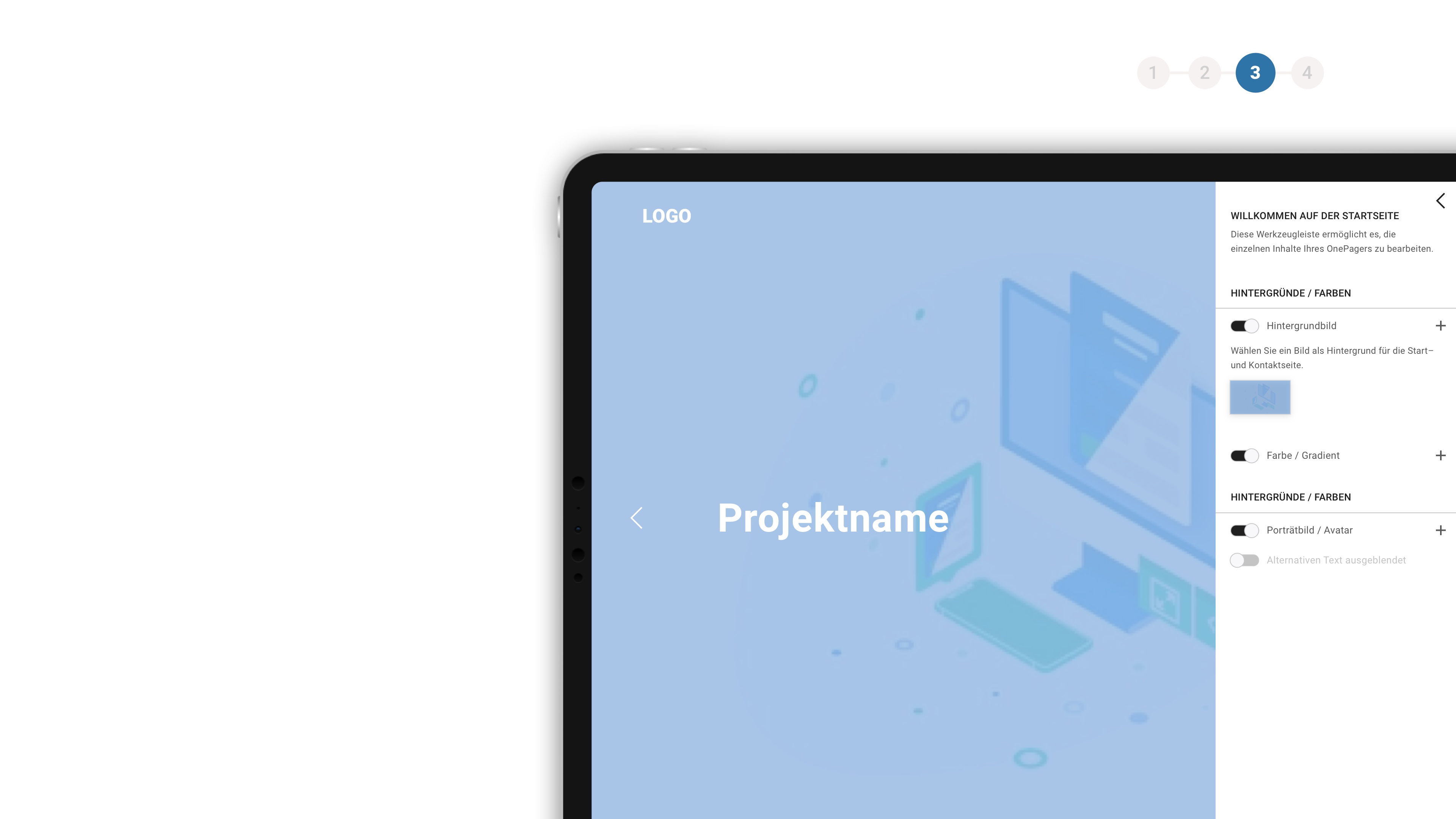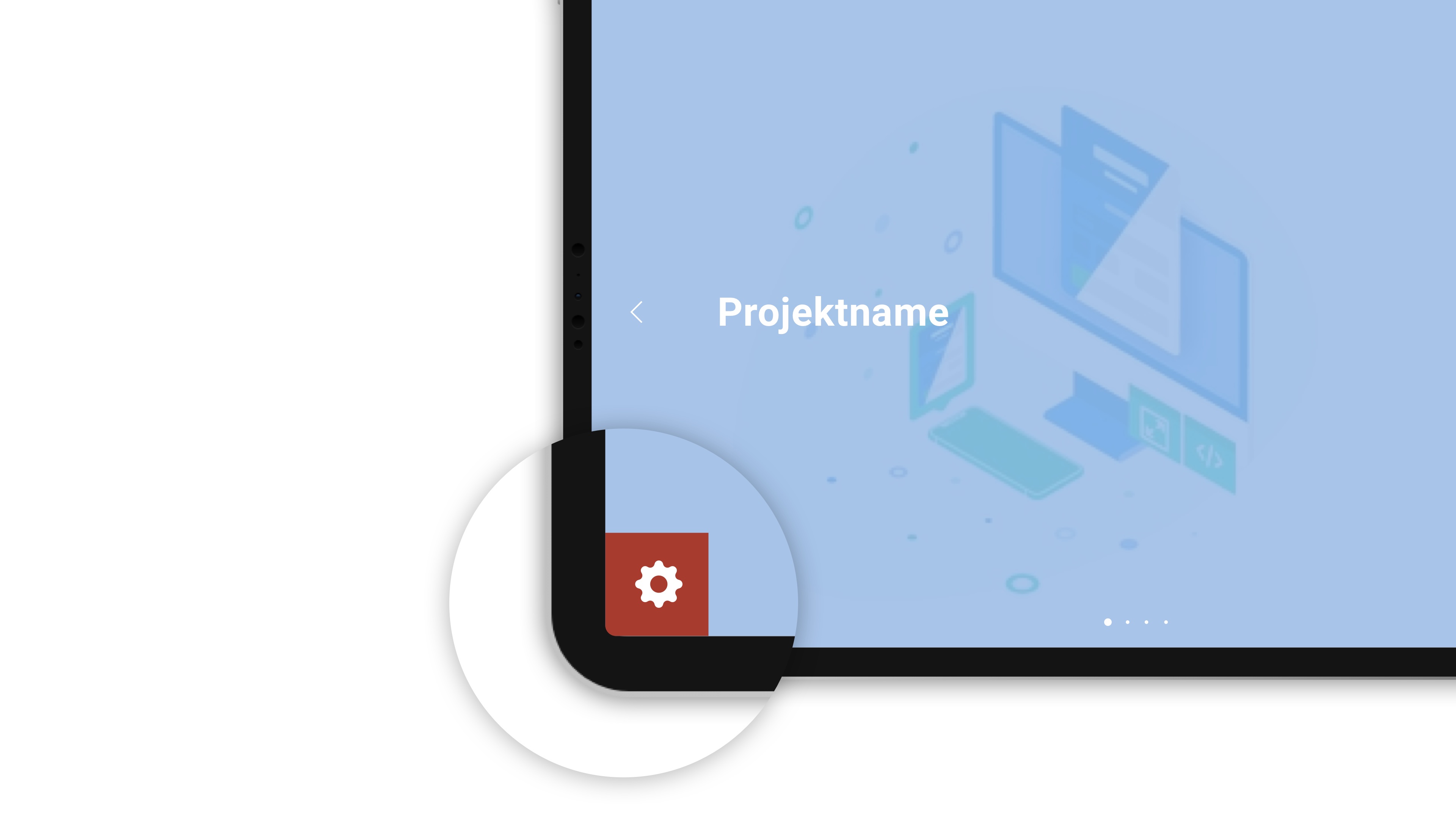Freedom between Resignation and Revolution - Deutsche Oper Berlin
Frei zwischen Resignation und Revolution
Bemerkungen zu Stefan Herheims Neuinszenierung von Alexander Meier-Dörzenbach
„I. Auch die Freiheit muss ihren Herrn haben.“
Richard Wagner setzte im Januar des Revolutionsjahres 1848 für sein erstes Abonnements-Konzert in Dresden mit der Königlich-Sächsischen Hofkapelle Beethovens EROICA auf das Programm. Diese heldische Symphonie war ursprünglich Napoleon Bonaparte gewidmet, doch als sich der revolutionäre Konsul zum Kaiser krönte, hatte er für Beethoven sein heldisches Potenzial als prometheischer Freiheitsbringer verraten, und der Komponist entzog ihm bitter enttäuscht die künstlerische Ehre noch vor der ersten öffentlichen Aufführung. Wagner interessiert an der Symphonie aber nicht dieser real-politische Hintergrund oder eine „Folge heldenhafter Beziehungen in einem gewissen historisch dramatischen Sinne“, sondern die zeitlose Aktivierung des Heroischen: „Zunächst ist die Bezeichnung ‚heroisch‘ im weitesten Sinne zu nehmen und keineswegs nur etwa als auf einen militärischen Helden bezüglich aufzufassen,“ notiert Wagner. Als der Komponist und Kapellmeister nach dem gescheiterten Aufstand aus Dresden als politisch Verfolgter 1849 nach Zürich ins Exil flüchten musste, organisierte und dirigierte er dort gleich abermals die EROICA. Er erinnert sich daran, wie er zur gründlichen Vorbereitung dafür drei aufwändige Proben ansetzte, um eine „Freiheit des Vortrags“ in der Aufführung zu erreichen; er notierte dann 1851 in seiner Analyse von Beethovens dritter Symphonie: „Begreifen wir unter ‚Held‘ überhaupt den ganzen, vollen Menschen, dem alle rein menschlichen Empfindungen – der Liebe, des Schmerzes und der Kraft – nach höchster Fülle und Stärke zu eigen sind, so erfassen wir den richtigen Gegenstand, den der Künstler in den ergreifend sprechenden Tönen seines Werkes sich uns mitteilen lässt.“ Wagner gelangt zur Erkenntnis, dass der letzte Satz der Symphonie „die überwältigende Macht der Liebe offenbart“; in den Schlusstakten rufe „der ganze, volle Mensch uns jauchzend das Bekenntnis der Göttlichkeit zu“.
Man kommt kaum umhin, in diesem ganzen, vollen Menschen, der uns jauchzend seine Göttlichkeit bekennt, den Wotan-Enkel Siegfried zu sehen, den Wagner nur Wochen später im ersten Textentwurf zur Initialfigur in seinem RING DES NIBELUNGEN ausgestaltet. Schon 1847 – während der Komposition des dritten Aktes von LOHENGRIN – schrieb Wagner an seinen späteren Widersacher Eduard Hanslick: „Je mehr ich mit immer bestimmterem künstlerischen Bewusstsein produziere, je mehr verlangt es mich, einen ganzen Menschen zu machen; ich will Knochen, Blut und Fleisch geben, ich will den Menschen gehen, frei und wahrhaftig sich bewegen lassen“. Nach LOHENGRIN schreibt Wagner viel über die Freiheit des Menschen – allerdings in theoretischen Texten über Politik und Oper und nicht in einer Komposition. Sein „ganzer Mensch“, der „frei und wahrhaftig sich bewegen“ lässt und „uns jauchzend das Bekenntnis der Göttlichkeit“ zuruft, erblickt im RING DES NIBELUNGEN das Licht einer künstlichen Welt. Da sich Wagner selbst einen Mythos aus nordischen Sagen, Märchen-Versatzstücken und Nibelungenlied schmiedet, sieht er die Möglichkeit des Dramas im Gegensatz zur Symphonik. So schreibt er Anfang 1852 an Hans von Bülow: „Denn – nochmals – die absolute Musik kann nur Gefühle, Leidenschaften und Stimmungen in ihren Gegensätzen und Steigerungen, nicht aber Verhältnisse irgend welcher socialer oder politischer Natur ausdrücken.“ Musik als Kunstwerk darf nicht nur in einer Absolutheit adoriert, sondern kann und soll auch als Ferment gesellschaftlicher Prozesse aktiviert werden. Die entscheidenden sozialen und politischen Verhältnisse aber, die im RING auszugestalten sind, beziehen sich nun auf genau diese Notwendigkeit, den Mythos zu erzählen und sein Spiel zu reflektieren, das sich aus dem Ringen um Freiheit ergibt.
„Freiheit“ ist als Begriff nicht nur wesentlich in die Revolutionsrhetorik Mitte des 19. Jahrhunderts eingeschrieben, sondern bleibt vielfach facettiert und sprachlich variiert im Zentrum des RINGS. Als zitiertes Schlagwort im Libretto taucht es substantivisch an zentraler Stelle im RHEINGOLD nur ein einziges einmal auf: Als Wotan dem gefangenen Alberich nach dem gesamten Nibelungenhort auch noch gewaltsam seinen Macht versprechenden Ring entreißt, schleudert der Nibelung seinen Fluch heraus: „Bin ich nun frei? Wirklich frei? – So grüß’ euch denn meiner Freiheit erster Gruß! Wie durch Fluch er mir geriet, verflucht sei dieser Ring!“ Der Schwarzalb Alberich wird von seinen Fesseln gelöst als „der Traurigen traurigster Knecht“, während der Lichtalb Wotan sich mit dem Ring als „der Mächtigen mächtigster Herr“ geriert. Dieser vermeintliche Gegensatz von Macht und Ohnmacht, von Freiheit und Gebundenheit, von Gott und Zwerg ist jedoch keine klare Dichotomie, sondern bedingt sich vielmehr gegenseitig.
Als Wagner im Spätsommer 1851 zu einer Wasserkur nach Albisbrunn reiste, integrierte er in der allerersten Prosaskizze zum Stück Wotan mit den Rheintöchtern badend in die Eröffnungsszene, doch im nächsten Entwurf, DER RAUB DES RHEINGOLDS, im März 1852 ist Wotan aus dieser Szene eliminiert und nur noch sein komplementäres Schattenbild Alberich präsent, der mit dem Raub des Goldes dann den Sündenfall vollzieht. Die Verbindung von Gott und Zwerg bleibt aber präsent: Mitten im Zwischenspiel von der ersten zur zweiten Szene wird das zuerst bei Wellgundes Erklärung „Der Welt Erbe gewänne zu eigen, wer aus dem Rheingold schüfe den Ring, der maßlose Macht ihm verlieh’“ gehörte, sogenannte „Ring“-Motiv wieder aufgenommen. Dessen gebrochene Nonenakkorde werden dreiklangartig freigesetzt, und es wandelt sich im Maestoso-Rhythmus zum „Walhall“-Motiv. Auf orchestraler Ebene wird so eine tiefe Verbindung zwischen Alberich, verschmähter Zwerg der Rache, und Wotan, untreuer Gott der Maßlosigkeit, hörbar: Die Tat Alberichs – das Verfluchen der Liebe zur Erlangung des mächtigen Golds – ist eine Form des Sündenfalls; die Tat Wotans – das Verschachern der Liebesgöttin zur Erbauung der mächtigen Burg – tatsächlich das Analogon. In klingender Ironie wird somit jede Form von Macht – auch die göttlich hohe – sogleich der Korruption überführt.
Der Schwarzalb will durch Liebesfluch Macht erzwingen, und der Lichtalb hat sich um den Preis der Liebe ein machtvolles Blendwerk erbauen lassen. Loge – ein Kofferwort aus Lohe und Lüge – lässt jedoch wissen: „In der Welten Ring nichts ist so reich, als Ersatz zu muten dem Mann für Weibes Wonne und Wert.“ Dieser „Welten Ring“ ist nun nicht nur der Erdenkreis, sondern kann auch als das Gesamtkunstwerk RING verstanden werden. Der RING erzählt keine Geschichte von Gut und Böse, sondern eine Geschichte, die Konzepte von Freiheit und Unfreiheit ausfranst; eine Geschichte, die den zur Liebe fähigen, „ganzen“ Menschen erzählen will, der sich dafür aus Verträgen und Traditionen, von Willkür und Furcht befreien muss; eine Geschichte, die utopische Kunst-Ideale spielerisch in Wirklichkeiten gestaltet und in die Zukunft der realen Menschen visionär hineinwirken will.
II. Exzessives „Es“
Die ersten beiden Takte von Beethovens EROICA wirken wie ein doppeltes Ausrufezeichen: Das ganze Orchester spielt forte zwei Es-Dur-Dreiklang-Schläge, die sich wie geballte Fäuste dem Publikum entgegenrecken – ein politisches Freiheitsdenken nicht mit, sondern in Musik. Wagner lässt diesen Es-Dur-Dreiklang zu Beginn des RHEINGOLD-Vorspiels erst einmal zur Schöpfung einer Welt langsam entstehen: Ein oktaviert tiefes Es brummt aus dem orchestralen Schlund der Kontrabässe als Orgelpunkt hinauf, bevor ab dem fünften Takt dann die Quinte mit einem zweifachen B der Fagotte hinzutritt – eine reine Quinte wie am Beginn von Beethovens neunter Symphonie. Erst mit der Terz darüber entsteht der Dur-Dreiklang, so dass 136 Takte lang die Tonalität erhalten bleibt. „Im Anfang war der Ton, und der Ton war das Es und das Es war der Ton,“ würde ein RING-Evangelium ansetzen, das im RHEINGOLD dann mehrfach vom Sündenfall erzählt. Das Vorspiel verströmt knappe viereinhalb Minuten Musik der reinen, fließenden Harmonie – ein „Wiegenlied der Welt“, die Geburt der Welt aus dem Geiste der Musik.
Ein zeitliches Pendent dieses RHEINGOLD-Vorspiels existiert in der vermeintlichen Stille, die gerade mit einem für diese Inszenierung so zentralen Flügel assoziiert wird – dem radikalen Bruch innerhalb der Musikgeschichte. Im Jahre 1952 provozierte John Cage mit seinem Stück „4'33'' “ einen Skandal, als der Pianist David Tudor das dreisätzige Stück mit der Anweisung tacet spielte, das nur aus Stille bestand: Vier Minuten und 33 Sekunden lang wird nichts gespielt. Nur durch Öffnen und Schließen des Klavierdeckels wurde der Unterschied zwischen Satz und Pause evident; der Pianist brachte keine Klänge zu Gehör, sondern schwieg gemäß der Anweisung. Dennoch kann diese Stille nicht als Abwesenheit von Geräuschen erfahren werden, sondern nur in der Aufgabe des Vorsatzes, etwas zu hören; also durch die Bewusstseinsänderung, eine Abwesenheit von beabsichtigten Geräuschen anzunehmen. Nichts von dem, was man vier Minuten und dreiunddreißig Sekunden lang hört, hat der Komponist geschrieben: die draußen vorbeijaulende Feuerwehrsirene, geflüsterte Kommentare, die surrende Klimaanlage im Saal, das Bonbonrascheln der Nachbarin, das eigene Füßescharren und vieles andere mehr – man wird auf jeden Fall etwas hören, aber der musikalische Interpret spielt nichts. Das führt nicht nur zu einer Intensivierung der eigenen Wahrnehmung als aktiv partizipierendes Mitglied des Publikumkollektivs, sondern erhebt auch die Geräusche der Umgebung zum Klang. Aber ist dieser aleatorische Klang nun Musik?
Die analoge Zeitspanne des Anfangs von Wagners RING erfährt man als das genaue Gegenteil: Die knapp viereinhalb Minuten des RHEINGOLD-Vorspiels ziehen einen immer tiefer in die Welt einer klingenden Intensität des ewig strömenden „Es“. John Cage hat sich mit seinem 273 Sekunden dauernden Stück – vielleicht auch eine Referenz an den absoluten Nullpunkt bei -273 °C – rezeptionsgeschichtlich in die Postmoderne eingeschrieben, in dem er den Komponisten herausgeschrieben hat. Wagner hingegen nutzt das „Es“ als mythisch personalisierten Brennpunkt seiner selbst, um das Freiheitsstreben der vermenschlichten Götter und vergötterten Menschen bis hin zum finalen Weltenbrand, der nicht das Ende, sondern ein Nicht-Mehr bedeutet, zu erzählen. Das atmosphärische Vorspiel in Es-Dur erobert sich in immer ekstatischer fließender Steigerung den Raum – den kollektiven Bühnenraum der Oper sowie den individuellen Rezeptionsraum der Seelen im Publikum. Die kreisende Musik gelangt so vom Gestaltlosen zur Form, vom Stillen zur Bewegung, vom Dunkel ans Licht, vom Unbewussten zum Bewusstsein. Doch jeder Schöpfungsmythos fängt mit einem heimtückischen Trugschluss an, denn es muss bereits immer ein Erzähler, eine vermittelnde Instanz, ein treibender Trieb, ein subjektives „Es“ existieren, das wir hier sogar als Ton mit natürlicher Obertonreihe hören. Wir erleben hier keine creatio ex nihilo, sondern vielmehr eine Evolution aus der vielfältigen Perspektive eines Nicht-Mehr, beziehungsweise eines Noch-Nicht des aus Unfreiheit geflüchteten Kollektivs, das sich um das Klavier wie um eine virtuelle Feuerstelle versammelt, um auf der Suche nach gesellschaftlicher und individueller Freiheit die mythische Geschichte der Lieblosigkeit von Macht und der Machlosigkeit von Liebe zu erzählen.
Wagner selbst hingegen stilisierte das Vorspiel in einer romantischen Erzählung: Während eines Mittagsschlafes will er das Es-Dur-Initial der bedingten Ruhe und der rauschenden Bewegung empfangen haben. In MEIN LEBEN erzählt er von der sogenannten „Vision von La Spezia“ in einem Hotel in Italien nach einer langen Wanderung im Spätsommer 1853:
„Am Nachmittage heimkehrend, streckte ich mich todmüde auf ein hartes Ruhebett aus, um die lang ersehnte Stunde des Schlafes zu erwarten. Sie erschien nicht; dafür versank ich in eine Art von somnambulem Zustand, in dem ich plötzlich die Empfindung erhielt, als ob ich in ein stark fließendes Wasser versänke. Das Rauschen desselben stellte sich mir bald im musikalischen Klange des Es-Dur-Akkordes dar, der unaufhaltsam in figurierter Brechung dahin wogte; diese Brechungen zeigten sich als melodische Figurationen von zunehmender Bewegung, nie aber veränderte sich der reine Dreiklang von Es-Dur, der durch seine Andauer dem Elemente, darin ich versank, eine unendliche Bedeutung geben zu wollen schien. Mit der Empfindung, als ob die Wogen jetzt hoch über mir dahinbrausten, erwachte ich in jähem Schreck aus meinem Halbschlaf. Sogleich erkannte ich, dass mir das Orchester-Vorspiel zum RHEINGOLD aufgegangen war, wie ich es in mir herumtrug, doch aber nicht genau hatte finden können, mir aufgegangen war, und schnell begriff ich auch, welche Bewandtnis es durchaus mit mir habe: nicht von außen, sondern nur innen sollte der Lebensstrom mir zufließen.“
Hier kreiert ein Erzähler bewusst eine mythische Kunst-Schöpfung aus dem Halbschlaf; just das hat Wagner auch mehrfach in Briefen getan, um etwas Natürliches zu suggerieren, das nichts mit Arbeit zu tun hat. Die Skizzen und Korrekturen zum Vorspiel belegen allerdings einen ganz anderen Hergang der Komposition: Im verwerfungsreichen, sehr bewussten Prozess entsteht langsam das Vorspiel – es ist das komplexe Ergebnis einer anstrengenden Arbeit, die Wagner im Schweiße seines Handwerks ausführt. Tatsächlich ist kein Teil von RHEINGOLD so radikal nach der Niederschrift des Gesamtentwurfs verändert worden wie das Vorspiel, dessen endgültige Gestalt wie bei einer Ouvertüre erst nach der Opernkonzeption verfertigt wurde. An Liszt schreibt Wagner eine Woche nach der Vision, als er wieder in Zürich angekommen ist: „[…] da kehrte ich um – um zu krepieren – oder – zu komponieren – eines oder das andere: nichts sonst bleibt mir übrig.“ Es ist nicht ein leichter Genie-Hauch der Natur, sondern vielmehr eine harte, schwere, zahlenmäßig genau und kunstvoll konstruierte Schmiedearbeit, die zum musikalisch mehrschichtigen und nur scheinbar organischen Vorspiel führt.
III. Das Spiel ums Spiel
Dabei hat sich Wagner selbst am Beginn der RING-Arbeit weniger mit dem Kunstschmied Mime als vielmehr mit Gottvater Wotan identifiziert: „Sieh Dir ihn recht an! er gleicht uns auf’s Haar; er ist die Summe der Intelligenz der Gegenwart“, schrieb der Komponist 1854 aus seinem Zürcher Exil an den inhaftierten Revolutionsfreund August Röckel, der dreizehn Jahre lang gefangen gesetzt wurde. Wotan verkündet dogmatisch bei seinem ersten Auftritt: „Wandel und Wechsel liebt, wer lebt; das Spiel drum kann ich nicht sparen!“ Das Spiel bezeichnet nun aber nicht nur Wotans Passion, sondern auch die selbstreferentielle Kerndynamik im Theater, wo die Illusion zur Wirklichkeit wird. „Spiel“ ist ein Terminus, der knapp ein Dutzend Mal in RHEINGOLD auftaucht – im Text von Rheintöchtern, Nibelung, Riese und Gott ebenso wie in den Regieanweisungen. Als Alberich sich den Rheintöchtern nähert, fragt er: „Stör’ ich eu’r Spiel, wenn staunend ich still hier steh’?“ Woglinde reagiert scheinbar überrascht: „Mit uns will er spielen?“ Das Spiel per se ist der Handlung und dem Inhalt eingeschrieben; es ist das titelgebende Rheingold am Grunde des Flusses, dem die drei Rheintöchter in besonderen Spielen huldigen: „Wonnige Spiele spenden wir dir: flimmert der Fluss, flammet die Flut, umfließen wir tauchend, tanzend und singend im seligem Bade dein Bett!“ Diese wonnigen Spiele der Rheintöchter lösen rationale Grenzen auf; metaphorisch werden hier Feuer und Wasser im wonnigen Spiel tanzend und singend verbunden – flimmert der Fluss, flammet die Flut: ein Spiel als mythischer Nucleus, in dem die im Alltag klar getrennten sinnlichen Elementbereiche von Feuer und Wasser fantastisch frei in F-Alliteration amalgamieren.
Diese Auflösung von Gesetzen alltäglicher Wirklichkeit und einer poetischen Kunst bestimmte auch die erste Aufführung in Bayreuth. Die drei anmutigen Rheintöchter waren – wie der 1876 präsente Komponistenkollege Camille Saint-Saëns notiert – „gleichsam flüssig und halbdurchscheinend […] Man kann sich nichts Entzückenderes denken. Sie haschen sich unter anmutigen Schwimmbewegungen“. Saint-Saëns ist es nun aber nicht nur ein Wunder, dass sie scheinbar „so mitten im Wasser schwebend gehalten werden“, er benennt es ganz klar: „ein Triumph der bühnentechnischen Illusion“. Hier spielen Technikwirklichkeit und Kunstanspruch, das bewusste Spiel und seine Illusionsmacht erfolgreich im Eindruck des revolutionär Neuen zusammen. Carl Brandt hatte nämlich Schwimmwagen konstruiert, die für die Rheintöchter allerdings eine physische Herausforderung waren: Auf je einen rollenden Plattform-Wagen wurde eine Stange montiert, die bis zu 6m ausgefahren werden konnte. Die Sängerinnen mussten über Leitern in ein drehbares Gestell einsteigen und wurden dort festgeschnallt. Unsichtbar für das Publikum war jeder Wagen unten mit drei Männern besetzt: einem Bühnenarbeiter, der den Wagen schob, einem Techniker, der die Maschine steuerte, und einem Musiker, der Fahrtempo und Stangenhöhe passend zur Partitur dirigierte. Die choreografische Bewegung zur Musik war Wagner wichtig, denn es war nicht vornehmlich ein naturalistischer Eindruck, der ihn interessierte, sondern vielmehr ein aus der Musik gewonnener Ausdruck im Spiel.
Es geht von Anfang an um das Spiel und spielen – ein Spiel der sinnlichen Verführung auf Handlungs- und Theaterebene, das ästhetisch gesetzt, aber zunächst nicht ethisch bewertet wird. Im RHEINGOLD entsteht ein Spiel aus dem vermeintlichen Nichts, das alles ist, ein kollektives Spiel, das Welten hervorbringt, dem das Individuum anheimfällt, ein magisches Spiel, das die Kunst von der Lüge befreit, Gegenteil der Wirklichkeit sein zu müssen.
IV. Freiheit und Liberty 1876
Die Uraufführung von DAS RHEINGOLD fand bereits 1869 gegen den ausdrücklichen Willen Wagners in München statt. Der Dirigent Hans Richter hatte sich auf Wagners Geheiß zurückgezogen – er sollte den RING dann musikalisch bei der Uraufführung 1876 in Bayreuth schmieden –, und so dirigierte der Leiter der königlichen Vokalkapelle, Franz Wüllner, das Werk. Diesem gab Wagner gleich Alberich einen Fluch mit auf den Weg: „Hand weg von meiner Partiur! Das rath’ ich Ihnen, Herr; sonst soll Sie der Teufel holen!“, doch die Aufführungen fanden statt. DIE WALKÜRE wurde ebenfalls vorab auf Wunsch von König Ludwig II. 1870 uraufgeführt; Wagner hat dem König daher auch nunmehr nur noch den Klavierauszug von SIEGFRIED übergeben, um eine weitere Produktion zu verhindern. Doch die eigentliche Entstehung von DAS RHEINGOLD ist in seiner Einbindung in die RING-Tetralogie zu sehen und eröffnet glanzvoll 1876 die ersten Bayreuther Festspiele im eigens dafür erbauten Haus. In Bewunderung für Richard Wagner entstand parallel dazu „Rheingold“ – der gleichnamige Sekt der Kellerei Söhnlein. Dieses flüssige Rheingold war die erste deutsche Sektmarke, die ins Markenregister eingetragen wurde; sie gewann im gleichen Jahr auch die Große Medaille auf der Weltausstellung in Philadelphia 1876, auf der auch der Arm der Freiheitsstatue mit goldener Fackel zum ersten Male der Öffentlichkeit präsentiert wurde.
Die alkoholische Konsumware des Rheingolds wurde mit der Verfügung von Kaiser Wilhelm I. geadelt, indem kaiserliche Kriegsschiffe nur mit dieser Marke getauft wurden und weist kulturhistorisch in eine Richtung, die reale Flüchtlinge hervorbringen wird. Ebenso öffnet die Statue of Liberty ein Kapitel über die Ideale von Freiheit und die Realität der Immigranten, die dem Versprechen von „give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free“ gefolgt sind. Aber weder die Wagner-Begeisterung der deutschen Kaiser – Wilhelm II. ließ die Hupe seines ersten Automobils auf Donners „Heda! Hedo!“ stimmen – noch das goldene Fackellicht der Freiheitsstatue, das die müde, arme, Freiheit suchende Flüchtlingsmasse aller Herren Länder lockt, soll jetzt näher betrachtet, sondern vielmehr an Richard Wagners persönliche Anknüpfung an diese Welt-Ausstellung erinnert werden.
Die Centennial International Exhibition in Philadelphia fand 1876 anlässlich der Einhundertjahrfeier der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung statt, in der ja „life, liberty and the pursuit of happiness“ als unabdingbare Menschenrechte festgesetzt worden sind. In der Ausstellungs-Sensation wurden nicht nur Bells Telefon und Edisons Telegraf, sondern auch Popkorn und Heinz’ Tomaten-Ketchup, sowie die Monorail-Hochbahn und industriell in Serie gefertigte Schreib- und Nähmaschinen vorgestellt – Meilensteine der Moderne. Wagner wurde gebeten, zu den Eröffnungsfeierlichkeiten einen großen Festmarsch zu schreiben; er verlangte allerdings als Honorar für die Komposition die horrende Summe von 5000 Dollars. Aufgebracht wurde das Geld von Mrs. Elizabeth Gillespie und dem Frauenverein, die sich wünschten, das Werk möge ihnen gewidmet sein. So schrieb Wagner an den vermittelnden Theodore Thomas: „Einige zarte Stellen meiner Composition deutete ich meinen Freunden so, dass hier die schönen und tüchtigen Frauen Nordamerikas im Festzuge mit dahinschreitend zu denken wären.“ Seine Frau Cosima notiert allerdings ehrlicher Weise, dass Richard darüber klage, „dass er sich bei dieser Komposition gar nichts vorstellen könnte … außer 5000 Dollars“. In monumentaler Besetzung – u. a. dreifache Holzbläser plus Kontrafagott sowie der ganz neuen Basstrompete und Tamtam – wird eine aufsteigend akzentuierte Triole zum rhythmischen Kernmotiv einer bombastisch hohlen Komposition, die man „Variation über kein Thema“ nennen könnte.
Dass Wagner im Februar und März 1876 an diesem Marsch – seinem umfangreichsten – arbeitete, obwohl er in Wien und Berlin dirigierte, seine ersten Bayreuther Festspiele mit der Uraufführung des RINGS besetzte, organisierte und inszenierte, erklärt sich allein aus dem Wunsch nach Geld – immerhin stellt er dem eher mediokren Marsch-Klangkonstrukt für die USA ein für ihn immer wieder zentrales Motto voran: „Nur der verdient sich die Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss“ – keine Formulierung von ihm, sondern von Goethe, der seinen Faust dieser „Weisheit letzten Schluss“ im zweiten Teil kurz vor dessen Tod sprechen lässt. Das Streben nach Freiheit und ihr Gegenteil wird im RING dramatisch ausgestaltet: Es geht um die Freiheit des Gottes, der sich immer tiefer in Schuld verstrickt und sich daher in der WALKÜRE wünscht: „Denn einer nur freie die Braut, der freier als ich, der Gott!“ Das ist sprachwitzig und philosophieträchtig; was bedeutet Frei-Sein für den Menschen als Individuum und für die Menschen im Kollektiv? Eine Frage, die wir auch uns ungewohnter Weise in den letzten Monaten immer wieder haben stellen müssen. Was suchen die Menschen durch ihre „Götter“ für ihre Gemeinschaft? Wann kann für sie ein Frieden siegen?
Wenn sich Siegfried in der GÖTTERDÄMMERUNG Brünnhilde trügerisch in Gestalt Gunthers nähert, verkündet er: „Ein Freier kam!“ – das ist böse Ironie eines in Täuschung Gefangenen. Siegfried hat doch mit Brünnhilde Liebe und Wissen und mit dem Ring Macht und Reichtum besessen – kann man denn freier sein als dieser menschliche Götterenkel? Ist er nicht der „ganze, volle Mensch“, der „frei und wahrhaftig sich bewegen“ kann? Warum zieht er überhaupt wieder los? Ist frei von Geschichtsbewusstsein, frei von Gewissen, frei von Zukunftsangst vielleicht die eigentliche Gefangenschaft, in der er steckt und die ihn für Wagner als Figur so interessant macht? Schließlich schreibt der Dichter und Komponist seinen RING rückwärts – er beginnt mit SIEGFRIEDS TOD, stellt diesem dann DER JUNGE SIEGFRIED vor, anschließend kreiert er DIE WALKÜRE und zum Schluss erst DAS RHEINGOLD.
Die Freiheit, die Wagner sich mit dem Marsch für 5000 amerikanische Dollars erkauft hat, galt seiner Kunst; gleich Alberich nahm er das Gold, um sich daraus einen Ring zu schmieden und gleich Wotan sein Walhall auf dem Grünen Hügel in Bayreuth zu bauen. Doch konnte er sich sogar auch vorstellen, in die USA auszuwandern, um seinen Schulden zu entgehen und jenseits des Atlantiks seine Festspiele zu errichten; der RING selbst war immer auf der Flucht – die ersten Festspiele wurden ja ein finanzielles Desaster. Auch seine Witwe Cosima spricht später wiederholt davon, Bayreuth zu verlassen und für die Festspiele einen anderen Platz zu suchen – von Koblenz ist die Rede. Koffer packen und einen Ort für den musiktheatralen Mythos suchen; Koffer packen und eine neue Heimat finden; Koffer packen und hoffen anzukommen.
V. Reise in die Freiheit
Nach der Uraufführung in Bayreuth kommt der RING nach Berlin: Im Mai 1881 werden von Angelo Neumann im Victoria-Theater erfolgreich Aufführungen in den Bayreuther Original-Dekorationen gespielt, an denen der deutsche Kaiserhof ebenso wie Richard und Cosima teilnahmen; hier sahen letztlich mehr Zuschauer den RING als in Bayreuth. Neumann reiste die nächsten zwei Jahre quer durch ganz Europa und spielte 135 Zyklen, mit denen die Tetralogie seine Signifikanz verbreitete und als „Wagner-Theater“ durch Tantiemen zur wichtigsten Einnahmequelle des Komponisten wurde. Der RING auf großer Wanderschaft mit gepackten Koffern – allerdings in einer Ausstattung, mit der Wagner selbst nicht wirklich zufrieden war. Dass, was ihm ästhetisch in Konzept, Text und Komposition gelungen war, konnte er nicht auf der Bühne realisieren, daher verwundert es wenig, wenn Wagner als Resümee der Uraufführung sanft ironisch seufzte: „Nachdem ich das unsichtbare Orchester geschaffen, möchte ich auch das unsichtbare Theater erfinden“. Doch bleibt die Sichtbarkeit des Theaters wichtiger Bestandteil der Rezeption; das Drama lässt sich nicht von den Unzulänglichkeiten der Wirklichkeit befreien – jeder Ring umschließt eine Leerstelle, die man für den RING mit Freiheit spezifizieren kann.
Erdas Rat „Flieh des Ringes Fluch […] dir rat’ ich, meide den Ring!“ befolgt Wotan widerwillig beeindruckt und verkündet mit der Abgabe des Rings feierlich: „Zu mir, Freia! Du bist befreit.“ Doch diese erkaufte Freiheit für „Freia, die Holde, Holda, die Freie“ setzt den Lauf eines Gefangenseins fort. Fasolt hatte den Gott gleich zu Beginn gemahnt: „Was du bist, bist du nur durch Verträge; […] bandest uns Freie zum Frieden du: all deinem Wissen fluch’ ich, fliehe weit deinen Frieden, weißt du nicht offen, ehrlich und frei Verträgen zu wahren die Treu’!“ Die Freiheit des an Verträge gebundenen Gottes und die Freiheit, der zum Frieden gebundenen Riesen – die Freiheiten, die hier verhandelt werden sind nicht einfache Schlagwörter, sondern komplexe Konstrukte, die ihre Wirkungskraft im Handeln beweisen müssen. Wotan ist kein autarker Schöpfergott in einem mythischen Märchen, sondern eine psychologisch komplexe Figur, die versucht, den negativen Folgen des eigenen Handelns zu entkommen – um jeden Preis für seine Freiheit.
Seine Freiheit, den „Wandel und Wechsel“, das „Spiel drum“ will Wotan nun erreichen, indem er eine Burg bauen lässt. Als untreuer Gatte hofft er einerseits, sich Frickas Nörgelei damit vom Halse zu schaffen und als herrschender Gott andererseits, seiner Macht eine Trutzstatt errichtet zu haben. Wotan ist göttlich aufgrund seines Übermaßes: die Freiheit von Liebe und Macht will er im Spiel vereinen, doch das Spiel auf der Opernbühne wird nun über drei Abende hinweg letztlich die Unmöglichkeit dieser Verbindung erleben lassen.
Im germanischen Mythos schlägt der Regenbogen als Bifröst eine Brücke zwischen Midgard, der Erde, und dem Götterreich Asgard – und darauf bezieht sich Wagner, wenn Donner mit einem Hammerschlag die Wolken auflöst und sich zur neuen Götterbehausung ein Regenbogen bildet, den Froh erklärt: „Zur Burg führt die Brücke, leicht, doch fest eurem Fuß: beschreitet kühn ihren schrecklosen Pfad!“ Der Halbgott Loge hingegen kommentiert den Einzug der Götter in Walhall über diesen Regenbogen mit den musikalisch feuermotivisch umrahmten Worten „Ihrem Ende eilen sie zu, die so stark im Bestehen sich wähnen.“ Also auch hier die sinnliche Zusammenführung alltäglicher Gegensätze: feuermotivische Musik zu einem regennasses Farbenbild. Das vermag nur das Spiel, das das Kollektiv auf der Bühne und Wagner durch das Werk mit uns spielt. Die Götterdämmerung hat also schon im RHEINGOLD begonnen, nur haben die Götter noch nicht die Zeichen ihres eigenen Untergangs zu lesen gelernt, die mit den wuchtigen Schlägen der siebzehn schmetternden Blechbläser im Marsch mit Streichern und Trommeln immer lauter und lauter und damit in irreführender Stärke leicht ironisch ertönt. Der gewitzte Kritiker Oscar Blumenthal schlägt die Brücke zurück zum Anfang:
„Wagner gleicht Beethoven? – Mit Verlaub,
Ein Unterschied bleibt, ein schwerer:
Bei Beethoven war der Musiker taub,
Bei Wagner werden’s die Hörer.“
Wagner erinnert sich auch an sein drittes Abonnementskonzert im Revolutionsjahr 1848, in dem er Beethovens fünfte Symphonie vor dem König und der Öffentlichkeit aufführte: „auf dem ganzen Publikum lastete der düstere Druck einer Ahnung von nahen Gefahren und Umwälzungen“. Das ganze Konzertprogramm hatte Wagner mit Moll-Stücken konzipiert, doch als er die c-Moll Symphonie – Beethovens fünfte – anstimmte, änderte sich die gedrückt-angespannte Stimmung im Saal sofort: „die Symphonie beginnt, welches Aufjauchzen, welche Begeisterung! Aller Druck gehoben, Lebehochs auf den König, – wie erlöst verließ die jubelnde Menge das Haus. Das ist das Unsägliche dieser Kunst!“ Gerade einmal ein Jahr später während der Dresdner Aufstände im Mai 1849, die Wagner dann zur Flucht ins Zürcher Exil zwingen sollten, ereignet sich eine Beethoven-Begegnung, die er in MEIN LEBEN erinnert: „Am folgenden Morgen des Montags, 8. Mai, versuchte ich von meiner vom Kampfplatz abgeschnittenen Wohnung aus, um Erkundigungen über den Stand der Dinge willen, nochmals bis zum Rathause vorzudringen. Als ich hierbei über eine Barrikade bei der Annenkirche mich verfügte, rief mir ein Kommunalgardist die Worte zu: ‚Herr Kapellmeister, der Freude schöner Götterfunken hat gezündet, das morsche Gebäude ist in Grund und Boden verbrannt.‘ Offenbar war dies ein begeisterter Zuhörer der letzten Aufführung der Neunten Symphonie gewesen.“
Beethovens neunte Symphonie kann sowohl als Fanal für die blutige Revolution verstanden werden als auch in Wagners Worten als „Erlösung der Musik aus ihrem eigensten Elemente heraus zur allgemeinen Kunst.“ Beethovens Fünfte kann zu königstreuen Jubelrufen motivieren oder auch als Schicksalssymphonie des tauben Musikers gelesen werden; Beethovens dritte Symphonie mag als Plädoyer für die Freiheit leuchten, wurde skandalumwittert von Hans von Bülow 1892 zur Bismarck-Symphonie verklärt, und im Nationalsozialismus wird dann sogar berichtet, wie „aus den Tönen von Beethovens heroischer Sinfonie das Bild des Führers klar erschaut und in deutlicher Charakterisierung hellseherisch vorausgeahnt“ wurde.
Wagner unterschied – wie eingangs bereits zitiert – die absolute Musik, die nur „Gefühle, Leidenschaften und Stimmungen in ihren Gegensätzen und Steigerungen“ auszumalen versteht vom Drama, das „Verhältnisse irgend welcher socialer oder politischer Natur ausdrücken“ kann. Doch auch die musiktheatrale Botschaft – gerade wenn es um die Freiheit des Menschen geht – ist in poröse Umdeutbarkeit eingebettet. Die große Oper über staatliche Gewalt und Freiheitsstreben, Beethovens FIDELIO, wurde in postrevolutionären Aufbruchszeiten und im reaktionären Biedermeier, als Festaufführung in Nazi-Deutschland und zur Wiedereröffnung der Berliner Staatsoper nach dem Zweiten Weltkrieg sowie selbst am letzten Jahrestag der DDR 1989 in Dresden gefeiert. Die Musik entschwebt in ihrer Form vom kleinbürgerlichen Singspiel über das Musikdrama der Gattenliebe hinauf zum großen Oratorium der Freiheit und entlässt das Publikum damit ins euphorisch Ungefähre. Wagner hingegen beginnt die Freiheitssuche im RING in mythisch angeschrägtem Blickwinkel gebrochen – er lässt verlauten: „Meine Vorspiele müssen alle elementarisch sein, nicht dramatisch wie die Leonoren-Ouvertüre, denn dann ist das Drama überflüssig.“ Sein Drama entwickelt sich changierender Weise: Eine helle Trompetenfanfare führt zum strahlenden C-Dur der „Rheingold! Rheingold!“-singenden Wasserwesen, doch das von Streichern umleuchtete Motiv hat einen trügerischen Glanz, ein täuschendes Versprechen, das die Rheintöchter am Ende des Vorabends explizieren: „Traulich und treu ist’s nur in der Tiefe“. Der relevante Resonanzraum der klingenden Kunst bleibt der individuelle Zuschauer, der aus seiner Wirklichkeit in einen Kunstraum flüchtet und dabei gleichzeitig diesen wie seine Realität reflektiert, neu wahrnimmt und hofft, sich selbst als „ganzen, vollen Menschen“ zu befreien. Weder revolutionär noch resignativ, sondern vielmehr poetisch betrachtet Goethe die Befreiung: „Das Wort Freiheit klingt so schön, dass man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Irrtum bezeichnete.“