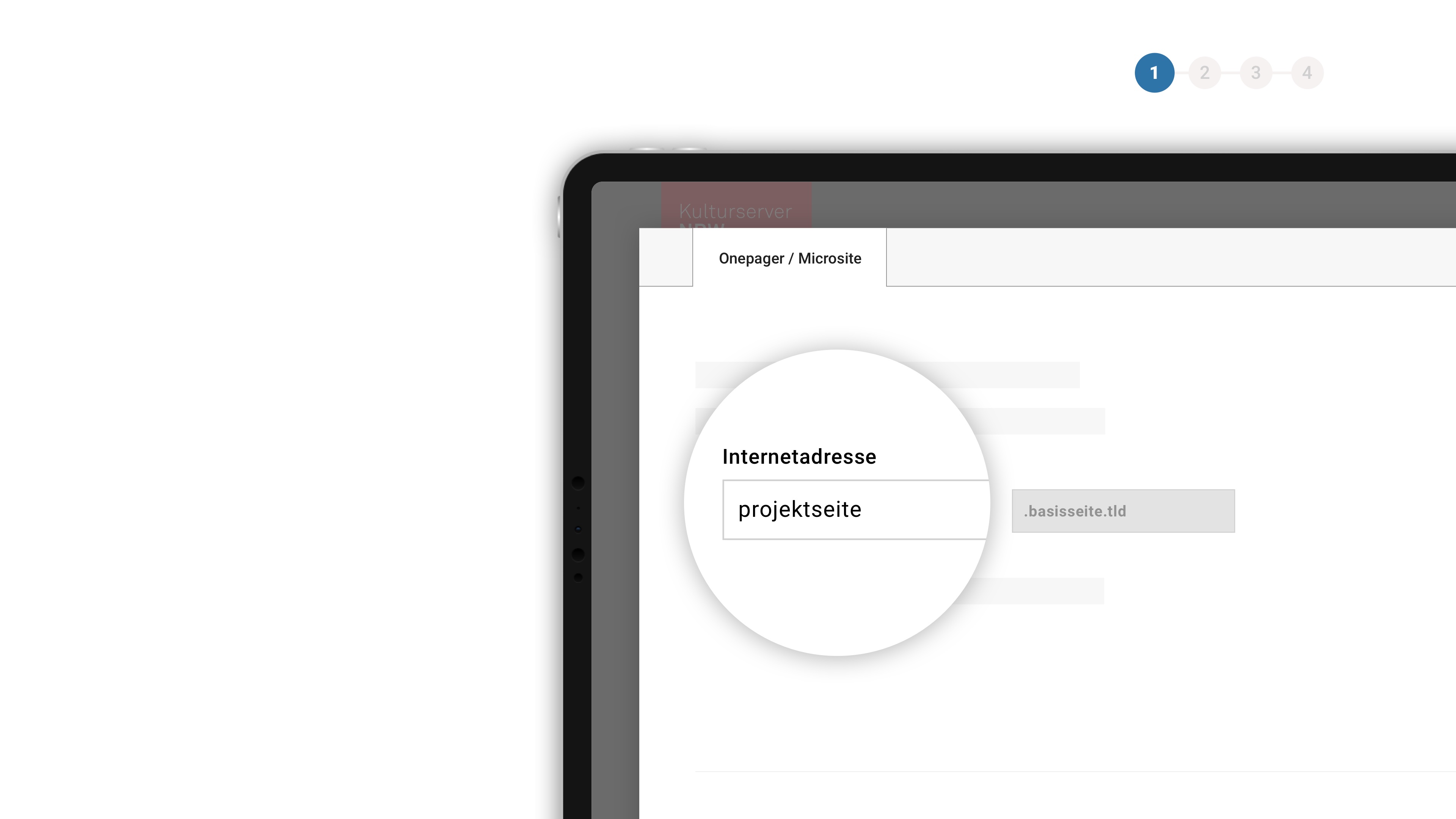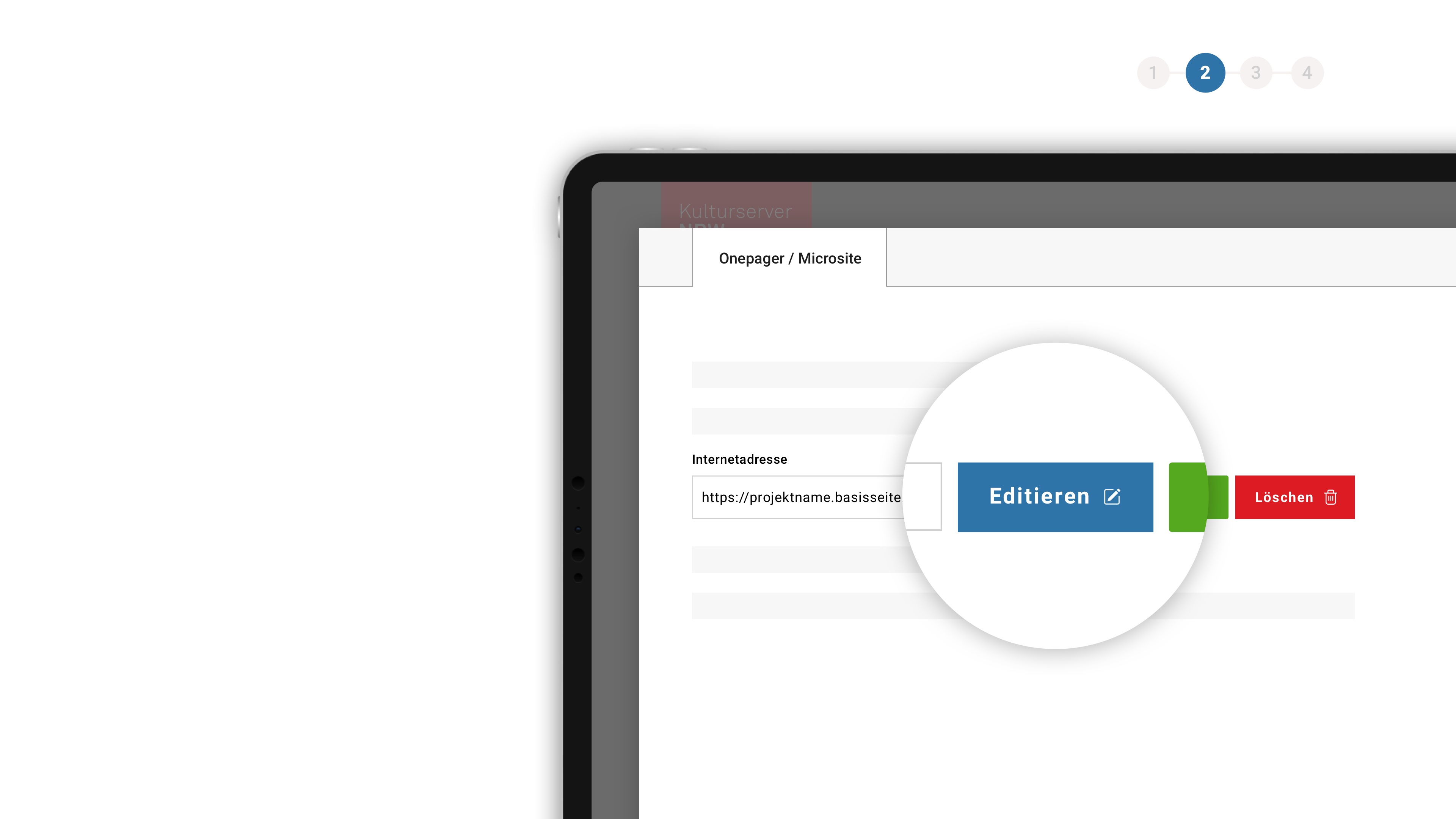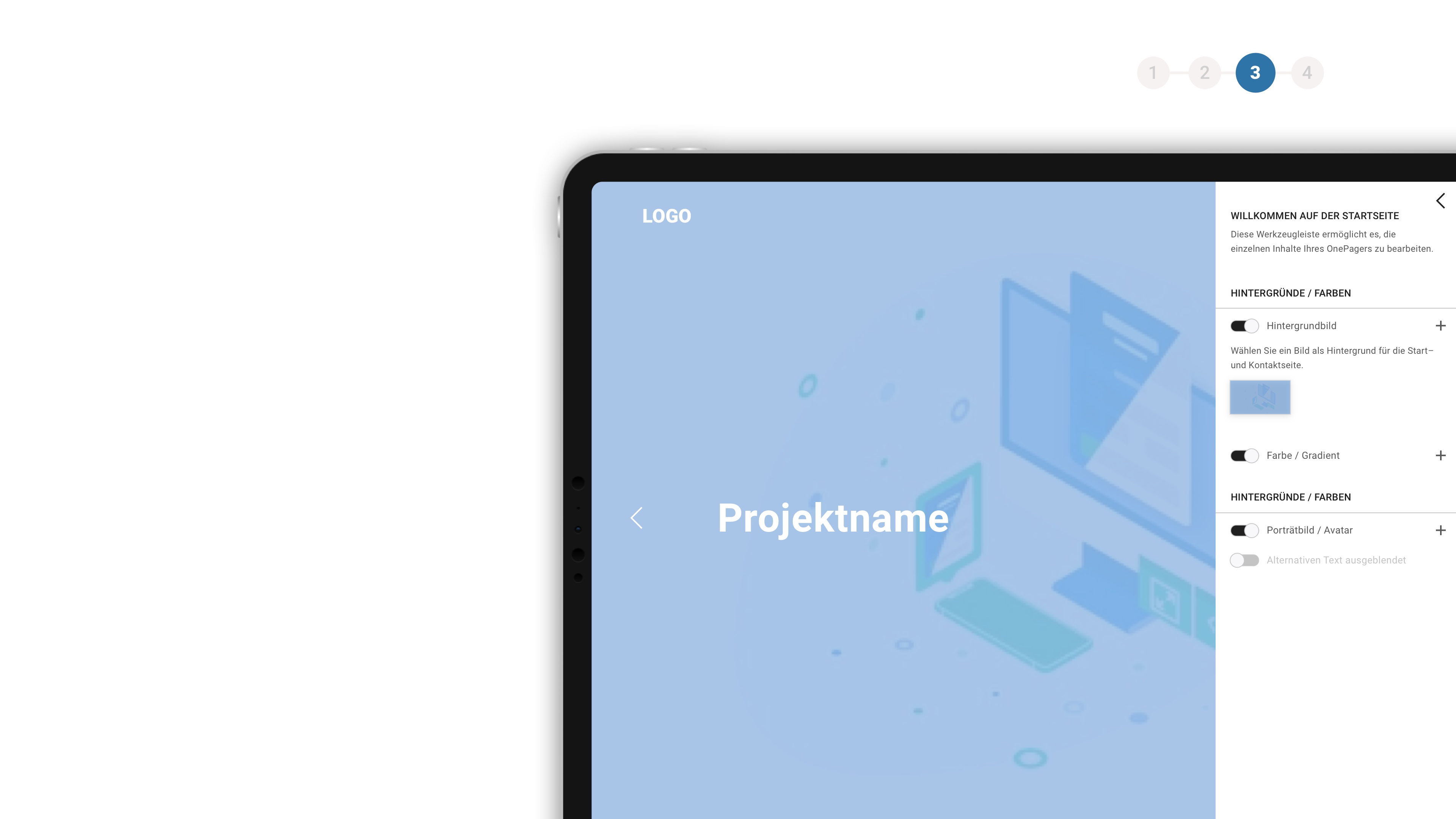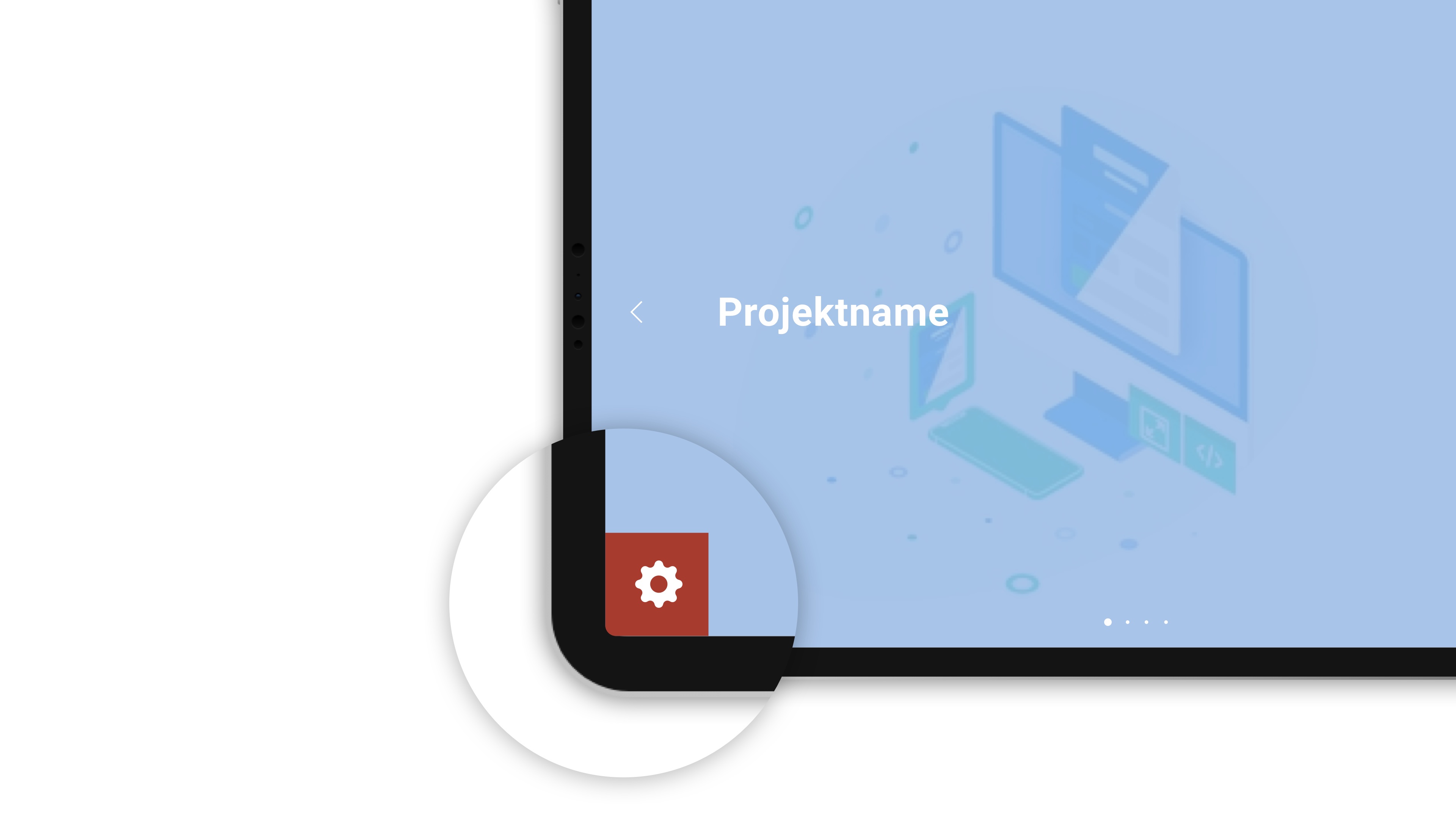»Leuchtende Liebe, lachender Tod!« - Deutsche Oper Berlin
Aus dem Programmheft
»Leuchtende Liebe, lachender Tod!«
Zur SIEGFRIED-Neuinszenierung durch Stefan Herheim ... Ein Essay von Alexander Meier-Dörzenbach
1. Zum Lachen: Guter Mime im bösen Spiel
Der von Richard Wagner hochgeschätzte und immer wieder konsultierte Gesangspädagoge Julius Hey erinnert sich in seinen Memoiren an eine SIEGFRIED-Probe mit Georg Unger in der uraufzuführenden Titelpartie und Richard Wagner als Mime, der die Rolle nicht nur markierte, sondern »die Partie den ganzen Akt hindurch mit voller Stimme« präsentierte: »Und wie sang er seinen ›Schulmeister Mime‹! […] – man vergesse nicht, dass er eine ›Stimme‹ im landläufigen Sinne gar nicht besaß!« Während der Tenor bald erschöpft ist – »Ungers gaumiger Gesang hörte sich gequält, farblos, ganz nebensächlich an« –, schuf Wagner, »durch eine unvergleichlich charakteristische Ausdrucksweise« eine Gestalt »von so scharfer, fest umrissener Ausprägung, wie sie von der Bühne herab vielleicht niemals erlebt werden wird!«
Hey erinnert sich, wie Wagner dem Tenor auch noch die »Heiaho«-Rufe beibrachte und mit seinen 62 Jahren selbst »trotz immerwährenden Sprechens und Singens – frisch und ›stimmhaft‹!« blieb. Wagners Spiel des Zwerges Mime rund um das Klavier in Ungers Bayreuther Wohnung in der Ziegelgasse führt Hey in eine Beobachtung, die für das gesamte Bühnenfestspiel DER RING DES NIBELUNGEN sprachlich eine Kernaussage zu treffen vermag: »Deutlich ließ sich aus dem zielbewussten Künstlerwillen heraus der Entwickelungsgang des Kunstwerkes in seiner dramatischen Gliederung verfolgen, von der allgemein poetischen Empfindung bis zur musikdramatischen Vollendung, herausgewachsen aus der unzertrennlichen Einheit von Wort und Ton!« Dieses Ineinandergewachsen-Sein von Wort und Ton bildet musiktheatral im Drama eine neue Intensität und gipfelt im SIEGFRIED in den jauchzenden Wiederholungen »Leuchtende Liebe, lachender Tod!«, die der Titelheld zusammen mit Brünnhilde als finale Aussage fortissimo im strahlenden C-Dur der Welt zujubeln. Darin werden nun nicht nur die Dichotomien von Liebe und Tod, von Licht und Schatten, von Eros und Thanatos zusammengeführt, sondern explizit auch das Lachen berührt.
Das Lachen spielt im RING eine besondere Rolle. Es findet sich über einhundert Mal im Text und in den Regieanweisungen der Tetralogie – über drei Dutzend Mal allein im SIEGFRIED – Mimes komponiertes Lachen auf einem Ton »Hihihi«, sein Kichern oder dessen orchestrale Wiederholung gar nicht mitgezählt. Es lassen sich grundsätzlich zwei Bedeutungsebenen des Lachens im RING ausmachen: Freude und Hohn. Schon im Vorabend wird das Rheingold als »leuchtende Lust, wie lachst du so hell und hehr!« in naturhafter Harmonie gefeiert, während Fricka Wotans »lachend frevelnden Leichtsinn« rügt und Alberich »mit wütendem Lachen« seinen Fluch auf den Ring ausbringt. Sinnliche Freude und höhnischer Spott sind von Anfang an mit Lachen konnotiert – zwei Seiten einer Medaille.
Siegfried, der das Fürchten noch nicht gelernt hat, wird bereits lachend eingeführt: »Mit lustigem Übermute« treibt Siegfried ein Untier gegen Mime, und nach seinen ersten Worten präzisiert die Regieanweisung: »Er lacht unbändig«. Sobald das Schreckenstier fortgejagt ist, wird Siegfrieds Aktion von der Anweisung spezifiziert: »setzt sich, um sich vom Lachen zu erholen.« Dieses Lachen ist also voll böser Häme, lebendiger Aggression und gleichzeitig voll spielerischer Freude und lässt an eine spätere Klassifizierung denken. Genau 100 Jahre nach der Geburt von Richard Wagner hat der ungarische Psychoanalytiker Sándor Ferenczi, engster Mitarbeiter und persönlicher Freund Sigmund Freuds, in einem Notizbuch 1913 folgendes festgehalten: »Lachen ist Erbrechen von Luft aus der Lunge, Weinen ist Saufen von Luft.« Diese Nähe zweier gegensätzlicher Empfindungen ist deutlich poetischer von Goethe gestaltet worden: »Endlich fasse dir ein Herz / Und begreif’s geschwinder: / Lachen, Weinen, Lust und Schmerz / Sind Geschwisterkinder.« Lachen und Weinen sind hier nicht als sprachliche Gegensätze, sondern vielmehr in familiärer Nähe platziert; ebenso wie das Erbrechen oder Saufen von Luft als Lachen oder Weinen bei Ferenczi lediglich eine Richtungsänderung des Sauerstoffs bezeichnet. Die Goethe’sche Geschwister-Formel, die noch Lust und Schmerz integriert, greift genealogisch auch im RING, wo das Lachen selbst nicht in einer klaren Binarität von Freude und Spott zu verstehen ist, sondern sich in zahlreichen Abstufungen und Übergängen zeigt.
Das Vorspiel zu Siegfried in b-Moll beginnt mit einem dumpfen Paukentremolo; dann ertönen unbehagliche Terzenfolgen im Bass, die durch eine verminderte Septime getrennt sind: das Grübelmotiv. Wir hören die düsteren Klänge der Nibelungen, Wehe- und Hortmotiv, das Schmiede-Ostinato, das Schwertmotiv Wotans und Siegmunds sowie das Motiv des fluchbeladenen Rings. Wir sind augen-, beziehungsweise ohrenscheinlich in einer düsteren Motiv-Melange, deren Fokus nicht unbedingt klar ist. Erinnert sich Mime? Grübelt Wotan? Grollt Alberich? Es geht ja in allen Leitmotiven immer wieder darum, sowohl Erinnerung zu wecken als auch Künftiges anzudeuten – mögliche komplexe Denkräume werden so geöffnet. Die Leitmotive sind eben nicht Erkennungsjingles, sondern etablieren – wie Thomas Mann so treffend formulierte – einen »Beziehungszauber«. Zwischen den Alben von Licht und Schatten ist der Zwerg Mime platziert, dem die ersten Worte der Oper gehören: »Zwangvolle Plage! Müh’ ohne Zweck!« Es wird ein langer Reiseweg bis zu den rhythmisch analogen letzten Worten der Oper, die ein Menschenpaar als utopisches Potential in die Welt hinausschleudern: »Leuchtende Liebe, lachender Tod!«
2. Zum Fürchten: Siegfried, Wotan und andere Männer
Am 12. Oktober 1848 notierte der Theaterleiter, Sänger, Schauspieler und Autor Eduard Devrient in seinem Tagebuch:
»Gegen Abend kam Kapellmeister Wagner […]. Er las uns seine Zusammenstellung der Siegfriedsagen vor; es war mit großem Talent gemacht. Er will eine Oper daraus bilden; das wird nichts werden, fürchte ich. Die nordische Mythe findet wenig Sympathie, schon weil sie unbekannt ist; und diese rohgeschnittenen Riesengestalten müssen der Einbildungskraft überlassen bleiben, die Wirklichkeit unserer Bühne macht sie klein und tändlich. Auch holt Wagner immer zu weit aus und knetet seine modernen Anschauungen ein.«
Die »nordische Mythe« ist inzwischen sehr bekannt und jenseits individueller Einbildungskraft längst vielfach in Wort, Bild, Ton – nicht zuletzt Film – konkretisiert. Aber macht die Wirklichkeit einer Bühne die Riesengestalten tatsächlich »klein und tändlich«? Holt Wagner immer zu weit aus? Knetet er – und besonders wir dann als Nachschöpfende – moderne Anschauungen ein? Und wenn ja – wäre das nicht wunderbar?!
Doch zunächst konkret zur Titelfigur: Wie stellte sich Wagner nun seinen Siegfried vor? Wagner charakterisiert Siegfried einerseits körperlos ideal – beispielsweise 1851 in EINE MITTEILUNG AN MEINE FREUNDE als »Geist der ewig und einzig zeugenden Unwillkür, des Wirkens wirklicher Taten, des Menschen in der Fülle höchster, unmittelbarster Kraft und zweifellosester Liebenswürdigkeit«. Doch in der gleichen Schrift wird die Figur mit einem fast schon erotischen Potenzial sinnlich porträtiert; Wagner beschreibt ihn als den »jugendlich schönen Menschen in der üppigsten Frische seiner Kraft […] der wirkliche, nackte Mensch, an dem ich jede Wallung des Blutes, jedes Zucken der kräftigen Muskeln […] erkennen durfte«. Geist der Tat und Körper der Jugend sollen zusammenfinden im sinnlichen Spiel um den »freien Helden«. Über die vielen Jahre der Entstehung dieser Oper resümiert Wagner dann 1870 über Siegfried: »Das Beste an ihm ist der dumme Junge, der Mann ist schauderhaft«. Auf den erwachsenen, aber bewusstseinslosen Mann lässt sich eben keine Welt aufbauen – »Leuchtende Liebe, lachender Tod!« ist eine ekstatische Aufnahme des Moments, in dem das Knabenhafte verschwindet, aber kein solides Fundament, auf dem sich ein erwachsenes Sein gestalten ließe.
Am Anfang des zweiten Aufzugs von GÖTTERDÄMMERUNG charakterisiert Alberich den Helden Siegfried daher punktgenau: »Lachend in liebender Brunst, / brennt er lebend dahin.« Siegfried ist Gegenwart, ist Moment – weder Erfahrungen vergangenen Unheils noch Sorge ob drohender Gefahr belasten ihn. Dass der Held, wie von Alberich konstatiert, lachend in liebender Brunst brennt, formiert sich im Finale des SIEGFRIED-Duetts: »Leuchtende Liebe, lachender Tod!« – ein Ausruf, der sich der gleichen Bildsprache wie Alberichs obiges Zitat bedient: Lachen, Liebe, Licht und Vergänglichkeit. Doch wie gelangt die Titelfigur nun dahin?
Der Held wird zum ersten Mal bereits im dritten Aufzug der WALKÜRE erwähnt – Brünnhilde nennt ihn den »hehrsten Helden der Welt […] im schirmenden Schoß« von Sieglinde. Er bleibt aber nicht namenlos, sondern bekommt gleich eine nominelle Identität zugeschrieben – Brünnhilde tauft ihn: »den Namen nehm’ er von mir – / ›Siegfried‹ erfreu’ sich des Siegs!« Sieglindes Reaktion darauf ist von größter Bedeutung, da uns ihr musikalisches Motiv im Finale der GÖTTERDÄMMERUNG wiederbegegnet: Es umrahmt Brünnhildes Schlussgesang und verkündet schlussendlich die Botschaft des gesamten Zyklus’ amorph in Musik. Wir kennen dieses Liebeserlösungs-Motiv bisher verknüpft mit der Reaktion Sieglindes auf die Verkündung ihrer Schwangerschaft mit Siegfried: »Oh hehrstes Wunder«!
Der einzige Sohn Richard Wagners, geboren 1869 – also mitten in der Komposition des dritten Aufzugs von SIEGFRIED – trägt den Namen des Titelhelden. Am ersten Weihnachttag 1870 wird in dankbarer Erinnerung an die Geburt des Sohnes Siegfrieds zu Cosimas 33. Geburtstag das »Siegfried-Idyll« uraufgeführt – ein Werk, das sich Melodien und Motive aus dem zweiten Tag der Tetralogie in Form der symphonischen Dichtung für Kammerbesetzung bedient. Trotz der gemeinsamen Töchter hatte Wagner Cosima erst wenige Monate zuvor geehelicht – erst der Geburt Siegfrieds folgend. Cosimas Tagebucheintrag nach dem Wochenbett beginnt mit dem Ausruf: »O Heil dem Tag, der uns umleuchtet, Heil der Sonne, die uns bescheint!« – mit den an den dritten SIEGFRIED-Aufzug angelegten Worten, drückt sie ihr taumelndes Glück über die männliche Nachfolge aus, die ihr wie Wagner weitaus wertvoller als die gemeinsamen Töchter schien. Mit Fidi war nun scheinbar der erlösende Nachfolger Fleisch geworden.
Auch wenn der Tod der Siegfried-Figur die Initialzündung für Wagners RING ist, entwickelt sich in der langen Entstehungsgeschichte Wotan zur interessanteren und entwicklungsreicheren Gestalt des Werkes. Im Sommer 1875 notierte Nietzsche auf ein loses Blatt in der Vorarbeit zu seinem RICHARD WAGNER IN BAYREUTH: »Wotan’s Verhältniß zu Siegfried ist etwas Wundervolles, wie es keine Poesie der Welt hat: die Liebe und die erzwungene Feindschaft und die Lust an der Vernichtung. Dies ist höchst symbolisch für Wagners Wesen: Liebe für das, wodurch man erlöst gerichtet und vernichtet wird; aber ganz göttlich empfunden!« Erlösung, Gericht und Vernichtung im Namen der Liebe – aber ganz göttlich empfunden… das ist ein sprachliches Extrakt der gesamten Tetralogie und fasst die tragische Dimension Wotans, Wagners und der Welt zusammen.
Der Auftritt von Gott Wotan als Wanderer im SIEGFRIED ist nicht nur musikalisch imposant – in der Uraufführung 1876 bekommt er sogar einen eigenen, blau leuchtenden Scheinwerfer und wird »von geisterhaftem Licht übergossen« wie es in einer Kritik heißt. Eduard Hanslick hingegen lässt sich davon nicht blenden: Er findet die Rätsel-Szene überflüssig und meint, sobald man nur die Spitze von Wotans Speer sieht, sei »eine halbe Stunde nachdrücklichster Langeweile garantirt«. Der spitzzüngige Kritiker freut sich dann, wenn Siegfried im dritten Aufzug den »schlafbringenden Speer des göttlichen Nachtwächters« spaltet und ihn damit zurück in die Kulissen schickt. Die neuartig farbige, fast schon expressionistische Beleuchtungsregie wurde bei den ersten Festspielen bewundert und scharf kritisiert, denn die hellen Verfolger auf Wotan decouvrierten immer wieder die Kulissen als solche; die Illusion wurde zerstört – aus dem Baum wurde gemalte Leinwand. Ein Kritiker mäkelt, man sähe »anstelle des Himmels ein gezogenes Segeltuch« – etwas, das wir heute als Spielprinzip nicht verstecken, sondern ausgestellt nutzen. Ein Segeltuch, beziehungsweise eine Projektionsseide, die den Figuren der Handlung, dem Fluchtkollektiv auf der Bühne und letztlich uns Zuschauern im Auditorium Zeichen einer bewussten Spielverabredung ist. Der wandernde Wotan bleibt Leiter dieses Spiels und weiß mit dem Seidentuch verzaubernde Illusionen und entzaubernde Realitäten hervorzubringen und agiert selbst in der Handlung, wenn er seine eigenen Spielregeln zu überlisten meint, um mit und dann durch Siegfried eine neue Welt zu etablieren.
Spielintern funktioniert dies beispielsweise mit dem Gezwitschere des Waldvögleins, durch das Wotan scheinbar regelkonform mit Siegfried indirekt kommuniziert. Wagner hatte die Rolle des Waldvogels eigentlich für eine Knabenstimme konzipiert; seit der Uraufführung wird sie allerdings meist mit einer Frau besetzt. Dabei sollte aus musikalischer Dramaturgie die erste Frau, die für Siegfried hör- und sichtbar, sinnlich erfahrbar wird, ganz klar Brünnhilde sein, die dem Knaben dann das Fürchten lehrt. Seit Wotan seinen Willen mit der Walküre in Schlaf versenkt hatte, waren ja überhaupt keine Frauenstimmen mehr im Werk zu vernehmen, bis dann Erda in der Begegnung mit dem Wanderer dieses Manko verlauten lässt: »Männertaten umdämmern mir den Mut«.
Richard Wagner erklärte König Ludwig II. in einem Brief 1869 die Bedeutung des Waldvogels für Siegfried: »Der Waldvogel, dessen Sprache er nun versteht, ist ihm wie das einzige Wesen, dem er sich verwandt fühlt. Und nun der Wonneschreck, als dieser ihm Brünnhilde verkündet!! Ja, und was das Alles heißt? Das ist keine Familienkinderszene; das Schicksal der Welt hängt von dieser göttlichen Einfalt und Einzigkeit des furchtlosen Einzigen ab!« Diese emotionale Verwandtschaft von Siegfried und Waldvöglein, die in der Bedeutung eben keine »Familienkinderszene« ist, sondern das Schicksal einer Welt bedeutet, lässt die Begegnung der beiden zwischen Poesie und Psychoanalyse platzieren. Siegfried erlangt kein reflektierendes Bewusstsein, sondern bleibt in naiver Gewalttätigkeit ein großes Kind. In der Begegnung mit seinem Enkel Siegfried setzt sich Wotan als Wanderer vom entschwundenen Waldvöglein zornig ab: »Es floh dir zu seinem Heil. Den Herrn der Raben erriet es hier: weh’ ihm, holen sie’s ein!«. Diese Raben – in der EDDA als Hugin (Gedanke) und Munin (Erinnerung) spezifiziert – werden in der GÖTTERDÄMMERUNG noch Bedeutung erlangen und letztlich beim Tode Siegfrieds assistieren.
Während das Waldvöglein im flatternden Diminutiv eine Herausforderung ist, wird die Darstellung des monströsen Drachen seit jeher eine vor allem technische Herausforderung. Das Ungetüm der Uraufführung, für das Wagner in England ein teures Meisterstück der Mechanik gekauft hat, konnte nur bedingt überzeugen: Ein Kritiker charakterisiert es als »Mittelding zwischen Eidechse und Stachelschwein mit Haarbüscheln« und nennt es eine »Sehenswürdigkeit, die auf dem Jahrmarkt taugt«. Wagner selbst sieht die Mängel des Drachen und schreibt an Ludwig II. 1878, man dürfe den Drachen »nicht im Profil«, sondern nur »en face« mit dem Oberleibe sichtbar werden lassen und schließt den Brief wieder einmal mit dem Hinweis darauf, dass er zur Abhilfe mehr Geld bräuchte. Der Drache löste Heiterkeit im Publikum aus und der bei der Uraufführung anwesende Camille Saint-Saëns schreibt wohlgestimmt, man finde »das gewagteste, was je im Theater geboten wurde […] man lächelt unwillkürlich ein bisschen über dieses Ungeheuer. Und doch ist es ein ganz ehrbarer Coulissendrache«. Ein Kritiker klassifiziert die Szene als »Puppenspiel für die reifere Jugend und das kindische Alter«. Doch nimmt man das abfällig gemeinte »Puppenspiel« und den belächelten »Coulissendrachen« ernst in ihrer bewussten Theatralität, dann lässt sich in dem Spielmechanismus eine Heldentat jenseits des märchenhaften Drachenkampfs erfahren, denn die theatrale Drachenhülle Fafners und der menschliche Klangkörper des Sängers decouvrieren eine Magie des Spiels – ähnlich wie der berühmte grüne »man behind the curtain« im ZAUBERER VON OZ die künstlerisch-kreative Konstruktion sichtbar werden lässt.
Wagner hat bereits 1851 über den Handlungsverlauf von SIEGFRIED in einem Brief notiert: »…dass er den wichtigsten Mythos dem Publikum im Spiel, wie einem Kinde ein Märchen, beibringt. Alles prägt sich durch scharfe sinnliche Eindrücke plastisch ein, alles wird verstanden«. Dem Publikum möge im deutlichen Spiel etwas beigebracht werden, und er expliziert sogar selbst den wichtigen Grund dafür, denn kommt erst der letzte Teil, GÖTTERDÄMMERUNG, »so weiß das Publikum Alles, was dort vorausgesetzt oder eben nur angedeutet werden musste, und – mein Spiel ist gewonnen.« Wagner ist derjenige, der bewusst mit uns ein Spiel um die Lieblosigkeit von Macht und die Machtlosigkeit von Liebe spielt und dieses dann im Finale von SIEGFRIED auf einen Höhepunkt führt. Tatsächlich sind es Noten zu der Szene von Siegfried und Brünnhilde aus dem Sommer 1850, die ganz am Anfang der sich über 26 Jahre hinziehenden Kompositionszeit des RINGS stehen – der Nucleus liegt in der utopischen Verklärung von Liebe als Gegenentwurf zur Macht. Damals schrieb Wagner auch den Walkürenritt in Reaktion auf Meyerbeer – er setzt sich also von Anfang an mehrfach mit Wuchs und Auswuchs der Gattung Oper auseinander und will im musikalischen Fluss des finalen Duetts leuchten und lachen.
3. Zum Lieben: Frauenträume – und Leben!
Wagner übermittelte bereits im Sommer 1851 August Röckel eine konzentrierte Inhaltsangabe von SIEGFRIED mit einem sprachlich etwas enigmatischen Ende: »Siegfried durchdringt das Feuer und erweckt Brünnhilde – das Weib zu wonnigsten Liebesumarmung. Nur noch eines: – in unseren feurigen Gesprächen gerieten wir schon darauf: – nicht eher sind wir das, was wir sein können und sollen, bis – das Weib nicht erweckt ist.« Dieses männliche Ganz-Sein erst durch die Erweckung des Anderen, des Weibes, ist ein ideelles Konzept, das Wagner selbst biografisch ein Stück weit pervertiert: Er nutzte Siegfrieds Verse vom strahlenden Ende (»Sie ist mir ewig,/ ist mir immer,/ Erb’ und Eigen,/ Ein’ und All’«) tatsächlich zwei Mal für eine briefliche Liebeswerbung; zunächst 1859 an Mathilde Wesendonck und dann knapp zehn Jahre später an Cosima von Bülow. Sein »ewig und immer«, das »Ein und All« ist menschlich gesehen doch wohl weit begrenzter, momentaner und poröser als im Kunstwerk vom Helden pathetisch versprochen – auch das bleibt also letztlich ein Spiel, dem wir auf der Bühne dann bewusst in GÖTTERDÄMMERUNG begegnen.
Philosophisch gesehen meinte Wagner allerdings das Männliche wie das Weibliche im Genie seiner Person zu vereinen und dann entsprechend in Text und Musik Ausdruck zu verleihen. Er notierte in einem Brief 1854: »allein (der Mann allein) ist nicht der vollkommene ›Mensch‹: er ist nur die Hälfte, erst mit Brünnhilde wird er zum Erlöser; nicht einer kann Alles«. Und genau an der Umsetzung dieser Erkenntnis, »nicht einer kann Alles« krankt der Prozess, an dem wir historisch gesehen oft in unserer Wirklichkeit ebenso scheitern wie das Kollektiv der Flüchtigen auf der Bühne. Das Finale von SIEGFRIED antizipiert in reinem C-Dur Jubel eine Welt, die wohl jenseits des Momentes gar nicht festgehalten werden kann.
Saint-Saëns findet die Schlussszene »ergreifend«, konstatiert aber, die Personenführung sei »nicht vollständig geglückt«, denn die Darsteller blieben »die ganze Zeit hindurch an derselben Stelle stehen, anstatt sich zu bewegen in der Erregung, die naturgemäß die gesteigerten Gefühlsausbrüche bewirken müssen.« Diese »gesteigerten Gefühlsausbrüche« sorgten bei Uraufführungskritikern für erstauntes Empören: Hanslick mokiert sich über die »Hitze eines überheizten Dampfkessels« und tadelt »das exaltirte Stöhnen, Stammeln und Schreien«, das typisch sei für Wagner »in solch brünstigen Scenen«. Speidel entrüstet sich über »die ganze Verstiegenheit der Wagner’schen Musik, ihre geschraubte Exaltation, ihr beständiges Außersichsein, ihre Liebesstammelei, ihre abstrakt-üppige Umschreibung geschlechtlicher Vorgänge« und Mohr fragt sich bei der Liebesszene, »wo das Künstlerische aufhört und wie soll man sagen? – das Pathologische anfängt«. Schletterer fasst die »mit faunischem Behagen ausgemalten Szenen […] wilder Brunst und überschäumender Lüsternheit« zusammen als »unbegreifliche Ausschreitungen des Geschmacks«. Diese unmittelbaren Eindrücke der Uraufführung nähern sich mit Begriffen wie »unbegreiflich« und »Außersichsein« den Fragen des künstlerisch überhaupt Darstellbaren. Ein »exaltiertes Schreien« klingt als Negativumschreibung dessen, was es dennoch im Kern trifft: den überhöhten Gesang in der Kunstform Oper. Und diesen erfahren wir auf besondere Art und Weise in der Begegnung von Siegfried und Brünnhilde.
Auch wenn Wagner sich ja für den Stoff den RINGS von der Handlung der GÖTTERDÄMMERUNG aus rückwärts interessierte, erkannte er gleich, wie wichtig die Herkunft Siegfrieds für sein Gesamtkonzept ist und schreibt daher nach SIEGFRIEDS TOD gleich den JUNGEN SIEGFRIED. In einem Brief 1851 an Theodor Uhlig heißt es: »Habe ich Dir nicht früher schon einmal von einem heitren Stoffe geschrieben? Es war dies der Bursche, der auszieht ›um das Fürchten zu lernen‹ und so dumm ist, es nie lernen zu wollen. Denke Dir meinen Schreck, als ich plötzlich erkenne, dass dieser Bursche niemand anders ist, als – der junge Siegfried, der den Hort gewinnt und Brünnhilde erweckt!«. In diesem »Erwecken« steckt nun weit mehr als nur ein Dornröschen-Kuss. Durch den Kuss von Siegfried und die Erweckung Brünnhildes passiert etwas Entscheidendes: Liebe bricht in das märchenmythische Geschehen ein, die den Titelheld erst zum Menschen werden lässt. »Der Liebeskuss ist die erste Empfindung des Todes, das Aufhören der Individualität. Darum erschrickt Siegfried dabei so sehr«, erläuterte Wagner während der Komposition 1869.
Beim Anblick von Brünnhildes Gesicht ist Siegfried sinnlich überwältigt, noch bevor er überhaupt ihr Geschlecht erkannt hat: »leuchtender Sonne lachendes Bild«, und auch Brünnhilde nutzt das gleiche Adjektiv, um den Heroen zu titulieren: »Leben der Erde! Lachender Held!«. In der Begegnung mit Brünnhilde wird das »wonnige Kind« Siegfried zum Mann, doch wie viel, beziehungsweise wie wenig er versteht, wird in der Zusammenführung von Lachen mit Liebe, Sehen und Tod in gelotologischem Exzess deutlich:
Brünnhilde
»Lachend muss ich dich lieben,
lachend will ich erblinden,
lachend zugrunde gehn!«
Siegfried
»Lachend erwachst du Wonnige mir:
Brünnhilde lebt, Brünnhilde lacht!«
Das strahlende Ende in C-dur jubelt einer neuen Welt zu und ist der utopische Moment per se in Musik: »Leuchtende Liebe, lachender Tod«; die fertige Oper hat sich damit von ihrem düster grummelnden Anfang in b-moll bis hin zu ihrem licht-lauten Ende um einen Ganzton erhöht. Das neue Paar insistiert geradezu auf »Leuchtende Liebe, lachender Tod!«. Dieser »lachende Tod« im ekstatischen Finale wird zum gemeinsamen Glücksgefühl, mit dem beide Figuren jeweils einen Teil ihrer bisherigen Identität zu vokalem Grabe tragen, um die Hoffnung auf ein neues Leben zu gebären. Ein Leben, das zwei Individuen für einen Moment erleben, doch lässt sich darauf etwas bauen? Siegfried jubiliert »Heil dem Tage, der uns umleuchtet!« während Brünnhilde beschwört »Nacht der Vernichtung, neble herein!« Die Verbindung der beiden Liebenden besitzt keine erlösende Macht jenseits des Augenblicks. Der rauschhafte Moment der Liebe ist in diesem Höhepunkt zu hören, doch wieviel Oper und wieviel Utopie – letztlich wieviel Spiel – wird damit ausgestellt? Der Prozess der Vernichtung beginnt im Moment der Erfüllung. Kann man dieser Liebe also institutionell vertrauen? Geht die lang besungene Sonne tatsächlich auf oder dämmert es nicht vielmehr den alten Göttern?
Nimmt man das Vorspiel und die drei Abende der RING-Tetralogie als monumentale Sinfonie in vier Sätzen, dann wäre SIEGFRIED das Scherzo; Cosima bezeichnete diese Oper als »eine Art Intermezzo«, Wagner selbst nennt es anfangs das »heitre Drama« und spricht dann in MEIN LEBEN vom »heroischen Lustspiel« und betont damit abermals den so entscheidenden Aspekt des Spiels. Wir haben einerseits das dinghafte Spiel mit Märchenzügen: die Herstellung des Schwertes, den Drachenkampf, das Waldvöglein – alles Handlungsmomente, die auf effektvolle Aktion setzen. Wir erleben aber gleichzeitig auch ein mythisches Spiel: Wotans fragende Gespräche mit Mime, Alberich und Erda zielen auf Reflexion über die Erlösung von seiner Urschuld.
Die vermeintliche Bildungsgeschichte des jungen Siegfried entpuppt sich als eine Tragikomödie um Liebe und Gewalt in der Findung des Selbst: Zahlreiche Lehrstunden zwischen allen Hauptfiguren mit Frage-Antwort-Spielen versuchen Ordnung und Sinn zu etablieren in einem Universum, das doch nur im ekstatischen Augenblick hell strahlt: »Leuchtende Liebe, lachender Tod!« und damit seinen eigenen Untergang bereits ankündigt. Der Siegfried am Ende der Oper vereint in sich nicht nur die unterschiedlichen Aspekte des Lachens, sondern in der Verbindung von Liebe und Tod weitaus größere Bögen: Er ist »Übermensch, Protagonist einer Kosmogonie – zugleich Märchenfigur, einer der auszog das Fürchten zu lernen« (Richard Wagner) ebenso wie »Hanswurst, Lichtgott und anarchistischer Sozialrevolutionär auf einmal« (Thomas Mann) – und gerade in diesem »auf einmal« liegt der andauernde Reiz des opernformelnden Versprechens »Leuchtende Liebe, lachender Tod!«.