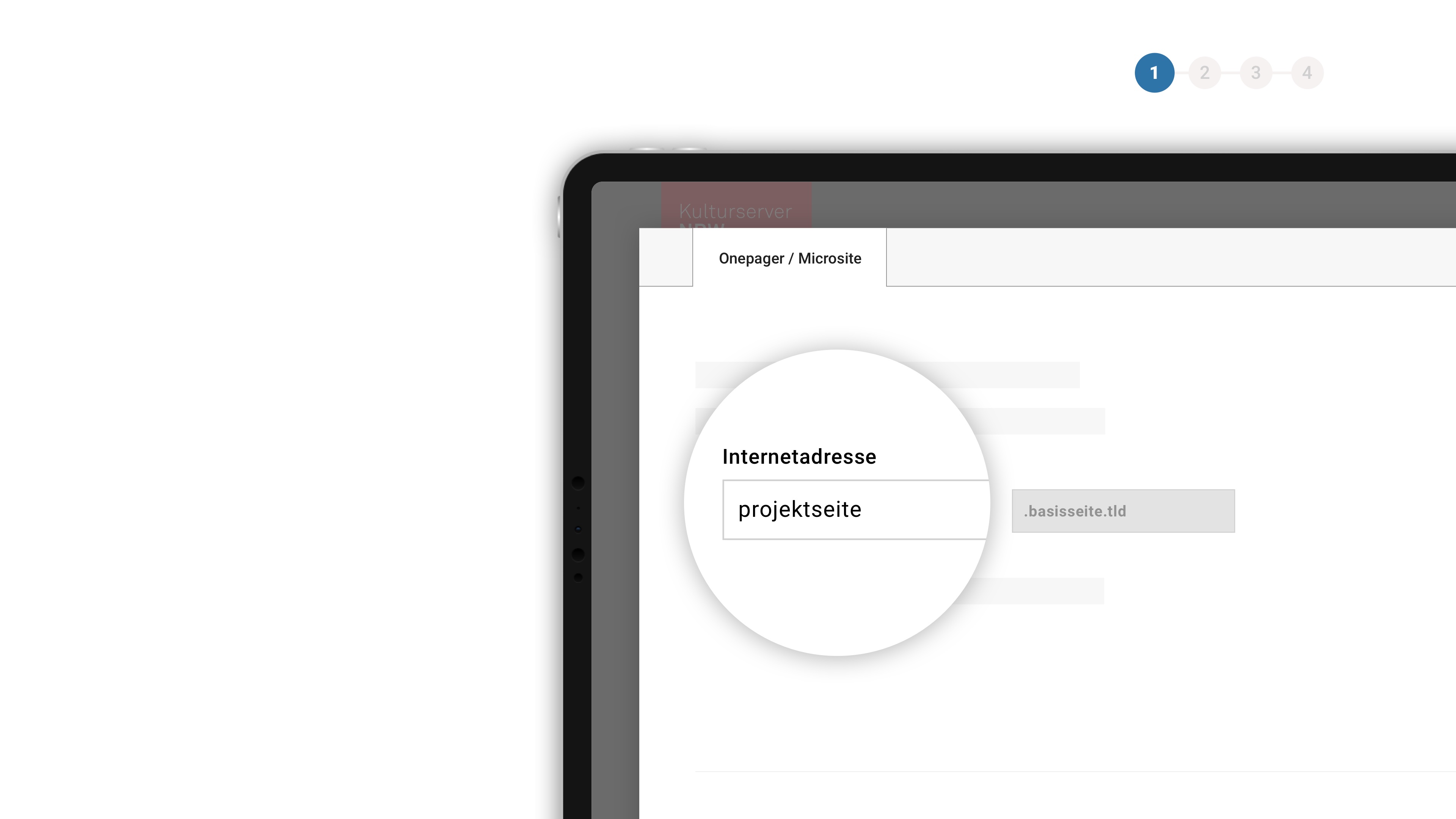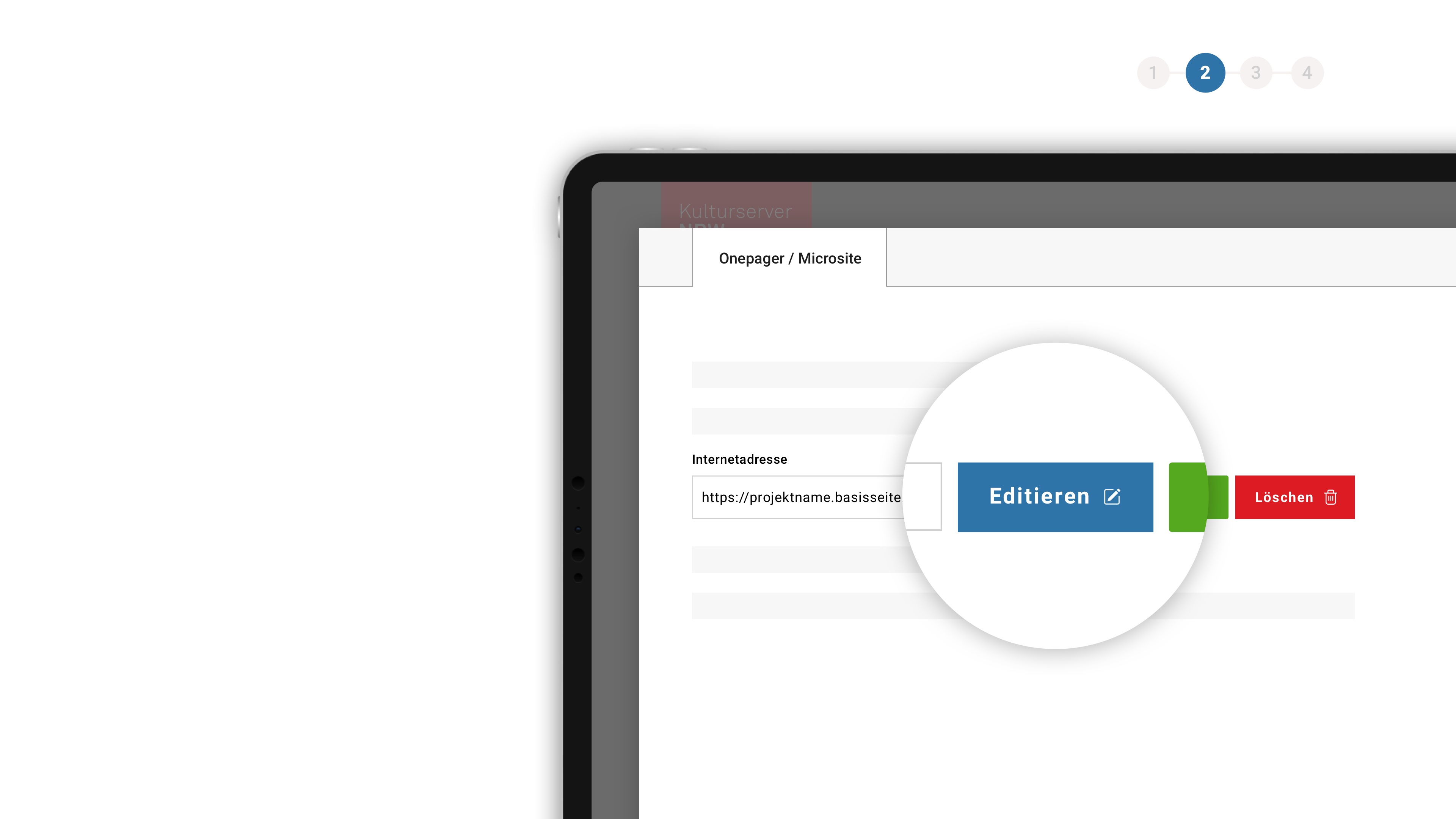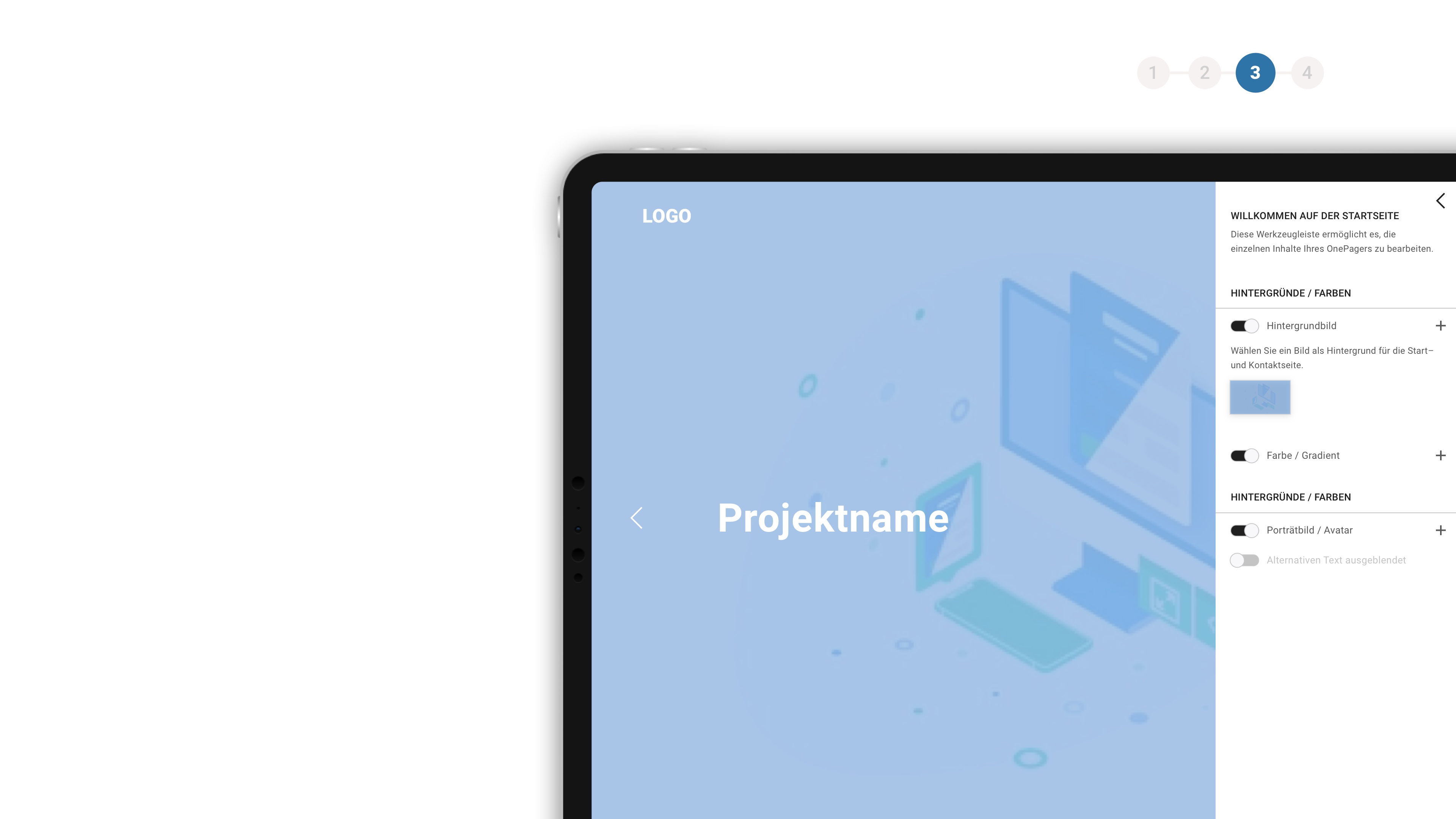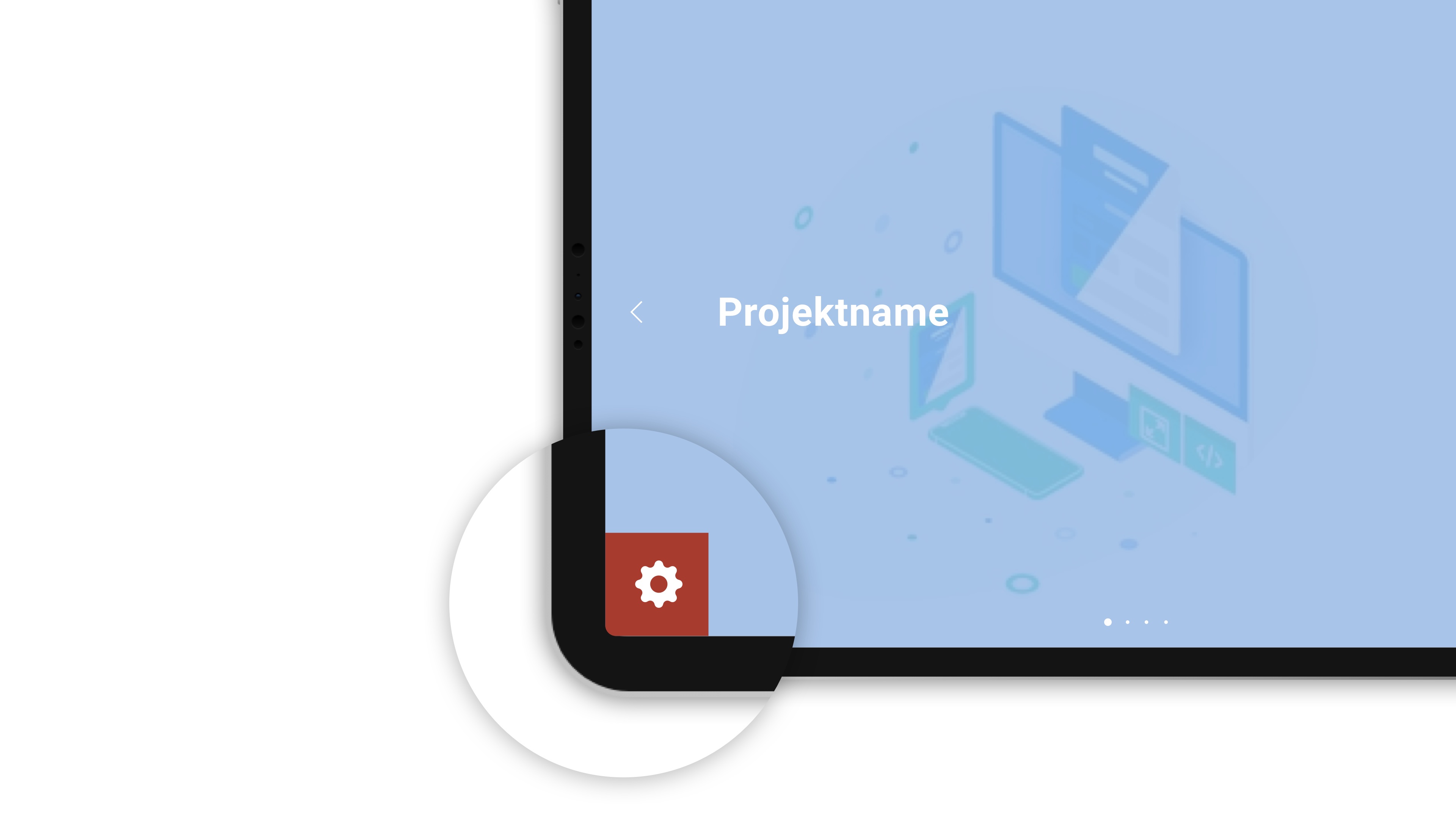Panda Blues - Deutsche Oper Berlin
Panda Blues
Ein Essay von Kai Strittmatter
Peking, letzte Februarwoche des Jahres 1972. Ein Spektakel, von Anfang an von beiden so gewollt. „Eine Woche, die die Welt veränderte“. Auf der einen Seite der Schöpfer dieses Zitats: Richard Nixon, US-Präsident und Kommunistenfresser. Bei ihm Henry Kissinger, Weltenbeweger und Schattenmann. Auf der anderen Seite Mao Tse-tung, Chinas Steuermann und roter Messias. Bei ihm Chou En-lai, Premierminister und für viele Chinesen Hüter des gesunden Menschenverstandes.
Wünscht man sich nicht manchmal, man könne dabei sein, in jenen großen historischen Momenten, dann, wenn es im Nachhinein so scheint, als hätten die Akteure in jenem Augenblick die Welt kurz angehalten und ihr dann einen Spin in die entgegengesetzte Richtung verpasst? Und zwar dabei sein nicht in der Fantasie von Drehbuchschreibern und Opernregisseuren, sondern wirklich Mäuschen spielen: lauschen dem, was damals tatsächlich gesprochen wurde? Wie reden sie miteinander, diese Menschen, die das Schicksal von so vielen Millionen anderen in der Hand haben, welche Wörter benutzen sie, welche Witze machen sie?
Tatsächlich gibt es mittlerweile öffentlich zugängliche Aufzeichnungen der Gespräche in Peking. Ein paar Szenen gefällig?
Mao zu Nixon: „Ich habe bei Ihrer letzten Wahl für Sie gestimmt.“
(Gelächter) Darauf Nixon: „Sie haben für das kleinere Übel gestimmt.“
Mao: „Ich mag die Rechten, ich bin ziemlich glücklich, wenn Rechte an die Macht kommen.“
Mehr als zwei Jahrzehnte hatten China und die USA da keinen diplomatischen Kontakt mehr zueinander gehabt. Es war die totale Entfremdung. Kein Kontakt, außer auf dem Schlachtfeld: Im Koreakrieg brachten Amerikaner und Chinesen einander um, im Vietnamkrieg kämpften die USA gegen den Kommunismus direkt an Chinas Grenze. Das China zu jener Zeit hatte sich abgekapselt von der Welt. Die dabei waren, sagten später, es sei gewesen als würde man „ins heutige Nordkorea gehen“.
Und dann dieser Coup. China hatte gebrochen mit der Sowjetunion. Und die Amerikaner rochen ihre Chance. Es war ein Akt des geostrategischen Opportunismus, auf beiden Seiten. Es war auch ein von beiden Führern wohl inszeniertes und von den Kameras der US-Sender aufgezeichnetes Theaterstück, eines, das die Welt in seinen Bann schlug, lange bevor ein Opernregisseur es auf die Bühne hob. Eines der ersten weltweiten Fernsehereignisse, als solches von manchen mit der Mondlandung verglichen.
Manche Dialoge fanden dabei hinter verschlossenen Türen statt. Der hier zum Beispiel, öffentlich gemacht erst 1999 in den „Kissinger Transcripts“.
Mao Tse-tung: „Der Handel zwischen unseren beiden Ländern ist momentan recht erbärmlich. Wie Sie wissen, ist China ein sehr armes Land. Wir haben nicht viel. Was wir im Überfluss haben, sind Frauen.“ (Gelächter)
Kissinger: „Auf die haben wir keine Quoten oder Zölle.“
Mao: „Also wenn Sie sie haben wollen, können wir Ihnen ein paar von denen geben, ein paar Zigtausend.“
Premier Chou: „Natürlich auf freiwilliger Basis...“
Mao: „Wollt ihr unsere chinesischen Frauen? Wir können euch zehn Millionen überlassen.“ (Gelächter, vor allem unter den anwesenden Frauen)
Kissinger: „Der Vorsitzende verbessert sein Angebot.“
Mao: „So können wir euer Land mit Unheil überschwemmen und euren Interessen schaden. In unserem Land haben wir zu viele Frauen ... Sie bringen Kinder zur Welt, und davon haben wir schon zu viele.“
Kissinger: „Das ist ein neuartiger Vorschlag, wir müssen ihn prüfen.“
Als der Komponist John Adams den Besuch 15 Jahre später in Houston auf die Bühne brachte, hatte er eine klare Vorstellung von seinen beiden Hauptpersonen. Die überlebensgroße Figur Mao wollte er heroisierend zeigen als den „Mao der großen Plakate und des Großen Sprungs nach vorn“. Er besetzte ihn als „Heldentenor“ und Richard Nixon als „selbstzweifelnden, lyrischen, manchmal selbstmitleidigen, melancholischen Bariton“.
Das Monströse an beiden Figuren blendete er aus. Richard Nixon war zum Zeitpunkt der Premiere längst als Schurke von Watergate in die Geschichte eingegangen. Und während der Watergate-Skandal erst ein paar Monate nach Nixons China-Besuch ins Rollen kam, war doch Nixons Rolle im Vietnamkrieg allzu bekannt: Allein den von Nixon angeordneten Bombardierungen Kambodschas („Operation Freedom Deal“) sollen von 1970 an zwischen 50.000 und 150.000 Menschen zum Opfer gefallen sein.
Und der „Mao der großen Plakate“? Seine desaströse Politik hatte allein während des erwähnten „Großen Sprungs nach vorne“ (1959-62) wahrscheinlich zwischen dreißig und vierzig Millionen seiner Landsleute umgebracht: Die meisten waren verhungert. Und 1972, zur Zeit des Nixon-Besuches, lief die von Mao orchestrierte „Große proletarische Kulturrevolution“: Ein teuflischer Schachzug Maos. Machtpolitisch grandios, menschlich eines seiner größten Verbrechen. Mao entledigte sich innerhalb der zehn Jahre von 1966 bis 1976 seiner Rivalen und schickte dafür sein Land in den kollektiven Wahnsinn. „Bombardiert die Hauptquartiere!“ rief er, und schickte die ihm blind ergebene Jugend des Landes zum Sturm auf die Autoritäten.
Die ihm schon entglittene Parteibürokratie war sein erstes Ziel. Dann alles, was nach Bildung roch. Dreizehn- und Vierzehnjährige schon formten sich zu Roten Garden, Mao ließ Schriftsteller foltern, Tempel niederreißen, Gräber schänden. Es war dies die Zeit, in der Schülerinnen ihre Direktorin totschlugen, in der Studenten ihre Professoren ersäuften, in der Ehemänner ihre Frauen ins Arbeitslager schickten und Söhne ihre Mütter aufs Schafott. Manche Klassenfeinde wurden lebendig begraben, andere geköpft und gesteinigt, in der Provinz Guangxi wurden mehreren Dutzend „Feinde“ Mao Tse-tungs Herz und Leber herausgerissen und verspeist.
Und als die Jungen ihren Dienst getan hatten, und ihre Orgie der Gewalt in einen Bürgerkrieg umschlug, da ließ Mao sie von der Armee zusammenschießen. Am Ende hatte der Große Vorsitzende die Macht zurückerobert. Und China lag in Ruinen. Millionen Menschen waren misshandelt und umgebracht, die Überlebenden seelische Krüppel. Eine Million Tote. Eine Volkswirtschaft in Ruinen. Ein Volk, dem das Rückgrat gebrochen worden war. Oder nein: das sich selbst das Rückgrat gebrochen hatte. 1976 war die Kulturrevolution offiziell vorüber, aber ihr Erbe vergiftet China bis heute.
Und während in China der Wahnsinn tobte, tat es ein Teil der rebellischen Jugend in Europa und den USA seinen Altersgenossen in Shanghai und Peking gleich und schwenkte voller Begeisterung kleine rote Mao-Bibeln: nicht das erste Mal, dass der Westen sich sein China jenseits der Realitäten selbst zusammenfantasierte. Nixon war nicht der Einzige, der gerne blind blieb.
Eine Mao-Bibel schwenkten er und seine Ehefrau allerdings nie, sie brachten ein ganz anderes Souvenir mit von ihrem Besuch. Tatsächlich gab der Reisebericht später First Lady Pat Nixon die Schuld. Die saß nämlich beim Bankett neben Premier Chou En-lai. Auf dem Tisch vor ihr stand eine kleine Büchse mit Zigaretten, umwickelt mit rosa Stoff und dekoriert mit zwei Pandas.
„Sind die nicht süß?“, sagte Pat Nixon. „Ich liebe sie.“ – „Ich schenke ihnen welche“, antwortete Chou. – „Zigaretten?“, fragte Pat Nixon. – „Nein“, sagte Chou: „Pandas“.Das war der Anfang. Einweihung des Panda-Hauses im Washingtoner Zoo im April 1972. Unmittelbarer Ausbruch schwersten „Pandamoniums“ (Pat Nixon) zuerst unter den Bürgern von Washington DC, später breitete sich das Virus aus in die ganze Welt. Seither gibt es die Panda-Diplomatie, ein genialer Schachzug der KP Chinas. Tatsächlich nannte Joseph Nye, der Erfinder des Soft-Power-Konzepts, die Pandas einmal Chinas „Äquivalent“ zur britischen Königsfamilie: „Du ziehst mit ihnen um die Welt und sie steigern die Soft Power deines Landes enorm“.
Der Panda ist seither die Wunderwaffe der KP. Soft-Power schwarz-weiß. Der Verdacht liegt nahe, dass die Partei sich den Panda ausgeguckt hat als Wappentier, weil er so niedlich ist, wie sie selbst gerne wäre. Oder vielmehr wie sie selbst gerne gesehen würde. Ein Riese, aber freundlich, friedlich, unbedrohlich.
Der Panda half. Aber mehr noch half der Zeitgeist: Man hatte im geostrategischen Ringen einen Sieg davongetragen, mit einem Mal China herausgebrochen aus der sowjetischen Achse. Für die atemberaubende Entwicklung, die dann folgen sollte, für Chinas Wirtschaftswunder und eine Globalisierung auf Speed also, musste erst einmal Mao sterben, was 1976 geschah, und wenig später Deng Xiaoping – Autokrat, Pragmatiker und Reformer in einem – seine Nachfolge antreten. Aber man kann guten Gewissens argumentieren, dass der Grundstein für die spätere Öffnung Chinas, für seinen Aufstieg zur Supermacht, in jenen Februartagen 1972 gelegt wurde. Die in den 1980er Jahren beginnende wirtschaftliche Kooperation zwischen dem Westen und China und die Entscheidung der Industrienationen, ihre Produktion zu einem großen Teil auszulagern und China mit seiner gut ausgebildeten, disziplinierten und billigen Arbeiterschaft zur Fabrik der Welt zu machen, war ein Grund für den Aufstieg des Landes.
Ein anderer waren die Reformen Deng Xiaopings, die das von Mao ruinierte und traumatisierte Land wieder vom Kopf auf die Füße stellten. Viele der von Deng angestoßenen Reformen waren eine direkte Reaktion auf die Gewaltherrschaft Maos: eine kollektive Führung ersetzte die Ein-Mann-Diktatur, Macht wurde dezentralisiert, die Ideologie in den Besenschrank gesperrt, Regionen und Städten wurden wirtschaftliche Experimente erlaubt. Dabei blieb Deng stets ein – oft skrupelloser – Hüter der Ein-Parteien-Diktatur, aber die Partei trat in den Hintergrund. Eine pragmatische Wirtschaftstechnokratie ersetzte die totalitäre Kontrolle und bot dabei auch Freiräume für Keime einer Zivilgesellschaft: Mit einem Mal organisierten sich auch in China Naturschützer, Feministinnen oder Bürgerrechtsanwälte, Intellektuelle stießen Debatten an und Künstler probierten sich aus jenseits sozialistischer Pflichterfüllung – eine Entwicklung, die die Partei nicht förderte oder gar guthieß, aber doch in jenem Maße tolerierte, in dem sie ihre Herrschaft nicht herausgefordert sah.
Es war diese KP eine, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte: eine Kommunistische Partei, die sich den Kapitalismus einfach einverleibte und als »Sozialismus chinesischer Prägung« ausgab, ein Wunderwesen von phänomenaler Anpassungskraft. Ihren autokratischen Kern gab sie dabei nie auf.
Und so wurde China jenes wunderliche Mischwesen aus leninistischen Machtstrukturen und urkapitalistischem Wirtschaften, das Besucher aus dem Ausland für Jahrzehnte in eine Mischung aus Begeisterung und gleichzeitig oft heillose Verwirrung stürzte – eine Verwirrung, die dazu beitrug, jene Fantasie zu gebären, die da ausrief: China wird so wie wir! Automatisch! „Wandel durch Handel“, hieß der Zauberspruch auf Deutsch. Wider alle Evidenz natürlich und trotz jenes schockierenden Momentes 1989, als die Parteiführung um Deng Xiaoping die Demokratiebewegung vom Platz des Himmlischen Friedens mit Panzern niederrollen ließ. Aber auch nach dem Massaker von 1989 dauerte es nicht lang, bevor das Geschäftemachen weiterging. Die Partei bot dem Volk nach 1989 einen Deal an: Ihr dürft Geld machen, dafür haltet ihr den Mund. Und das Volk schlug ein. Und so verwandelten sich Chinas Städte, getrieben von einer aufstrebenden Mittelschicht, endgültig in jene Orte des Konsums und Kommerzes, die durchreisende Geschäftsleute und Politiker so entzückten.
Das ist das China, das viele von uns ein Leben lang begleitete: das China von „Reform und Öffnung“. Das ist ein China, das nicht länger existiert, es macht gerade etwas Neuem Platz, einem politischen Wesen, wie es die Welt so noch nicht gesehen hat.
Und schuld daran ist dieser Mann: Xi Jinping. Xi trat an 2012, in einer Zeit, da die Zivilgesellschaft sich zunehmend zu emanzipieren schien, da eine nervöse, von Krisenstimmung gebeutelte KP so korrupt wie orientierungslos um ihre Zukunft und ihre Macht bangte. Und Xi trat an, die Herrschaft der Partei zu retten. Innerhalb kürzester Zeit schaffte er es, die vom Zerfall bedrohte KP in seinen eisernen Griff zu bekommen und eine vielfältige, lebendige, manchmal unbotmäßige Gesellschaft zu „harmonisieren“, wie das in China heißt, also die Stimmen der Andersdenkenden zu ersticken und jeden Winkel dem Gebot der Partei zu unterwerfen. Der sich unkorrumpierbar gebende Xi säuberte das Land und die Partei, auch ideologisch. Und dann machte Xi die Partei noch ein ganzes Stück gottgleicher, als sie schon immer war. Noch allwissender, noch allgegenwärtiger.
Wo Deng Xiaoping Pragmatismus verschrieb, huldigt Xi Jinping wieder der Ideologie: Er predigt Marx und praktiziert Lenin mit lange nicht gesehener Wucht und Strenge, und weil er spürt, dass Marx vielen Leuten nichts mehr sagt, schenkt er ihnen noch Konfuzius und stürmischen Nationalismus dazu. Wo Deng dem Land Öffnung und Neugier predigte, schottet Xi China wieder ab.
In den Jahrzehnten von Reform und Öffnung hatte es wenigstens im Unterbauch des Landes und auch der Partei stets Reformströmungen, originelle Debatten, verblüffende Experimente und mutige Tabubrecher gegeben. In Xi Jinpings China ist das nicht länger so. Xi macht Schluss mit wichtigen Prämissen der Reform- und Öffnungspolitik Deng Xiaopings. Sein China ist nicht länger ein Staat, der dem wirtschaftlichen Erfolg alles unterordnet – im Zentrum steht nun die politische Kontrolle. Seine Partei ist keine mehr, die Aufgaben abgibt an den Staat, an die Unternehmen, an die Zivilgesellschaft, an die Medien, die sich Freiräume erkämpft hatten. Xi hat die Freiräume wieder ausgelöscht.
Xi hat in den vergangenen zwölf Jahren eine Welle der ideologischen Säuberung nach der anderen durch das Land gejagt. Die Repression ist zurückgekehrt, so stark wie seit den Zeiten Maos nicht mehr. Ebenso der ideologische Eifer. Xi geht also mit einem Bein einen Riesenschritt zurück in die Vergangenheit. Manche vergleichen ihn mit Mao Tse-tung, aber der Vergleich hinkt stark: Mao war der ewige Rebell, der im Chaos aufblühte. Der Kontroll- und Stabilitätsfetischist Xi Jinping ist in vielem geradezu die Antithese zu Mao. Xi ist kein Revolutionär, er ist ein Technokrat, allerdings einer, der sich geschmeidig bewegt im Labyrinth des Apparats.
Chinas Diktatur unterzieht sich gerade einem Update mit den Instrumenten des 21. Jahrhunderts. Mit dem anderen Bein nämlich geht Xi einen Riesenschritt in die Zukunft: Das Regime hat nicht nur keine Angst mehr vor neuen Technologien – es hat sie geradezu lieben gelernt: China setzt auf Informationstechnologien wie kein zweites Land. Die Partei glaubt, mit Big Data und künstlicher Intelligenz (KI) Steuerungsmechanismen schaffen zu können, die ihre Wirtschaft in die Zukunft katapultieren und ihren Apparat krisenfest machen. Gleichzeitig möchte sie damit den perfektesten Überwachungsstaat schaffen, den die Welt je gesehen hat.
Und so kehrt nach mehr als einem halben Jahrhundert der Totalitarismus zurück nach China. Xis digitaler Totalitarismus ist allerdings ein viel smarterer Totalitarismus als der von Mao und Stalin einst: Er ist einer, dem man die Kontrolle oft nicht einmal ansieht – weil er sie dank der allgegenwärtigen technischen Überwachung in die Köpfe der Untertanen selbst verpflanzt.
Mao Tse-tung, sagt die Propaganda in China, habe die Feinde der Nation besiegt, Deng Xiaoping habe die Nation reich gemacht – und Xi Jinping macht sie nun stark, führt sie ins Zentrum der Welt. Xi schenkt seinem Volk den „chinesischen Traum“, die nationale Großmachtfantasie. Und wieder einen ideologischen Feind: den Westen. Er hat eine Botschaft an die Welt: China kehrt zurück an die Spitze der Nationen. Und die Parteimedien trommeln: Mach Platz, Westen! Macht Platz, Kapitalismus und Demokratie! Hier kommt zhongguo fang’an, die „chinesische Lösung“.
Mit einem Mal ist der Wettbewerb der Systeme zurück. Und mit einem Mal ordnen sich die Lager wieder neu: Die liberalen Demokratien hier. Und dort: China und Russland, wieder Seite an Seite. Und die USA? Sehen in China nicht bloß den System-, sondern auch den Großmachtsrivalen. China und die USA hätten 1972 unterschiedlicher kaum sein können, und doch sahen sie die Chancen in ihrer Kooperation. Wenn die beiden heute einander ansehen, dann sehen sie: Bedrohung.
Selbst die Pandas sind weg. Als im vergangenen November Mei Xiang und Tian Tian, die beiden Pandas des Washingtoner Zoos, zurückbeordert wurden nach Peking, da wollten viele Kommentatoren darin ein Symbol sehen. Die Stimmung zwischen China und den USA, schrieb etwa „Voice of America“, sei „eisig“.
Nixon in China? Das war damals. Heute ist: Xi in Russland. Xi und Putin, zwei, die sich zuletzt eine „Freundschaft ohne Grenzen“ versprachen. „Es geschieht ein Wandel wie wir ihn seit 100 Jahren nicht mehr gesehen haben“, sagte Xi vor einem Jahr zu Putin in Moskau. „Lassen Sie uns den Wandel gemeinsam gestalten.“ Und Putin antwortete: „Ich stimme zu.“
Kai Strittmatter hat den größten Teil seines Lebens der Beobachtung und Beschreibung Chinas gewidmet. Er studierte Sinologie in München, Xi’an und Taipeh und arbeitete über 14 Jahre als China-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Peking. Über China hat er mehrere Bücher geschrieben, zuletzt „Die Neuerfindung der Diktatur“ und „Chinas neue Macht“.